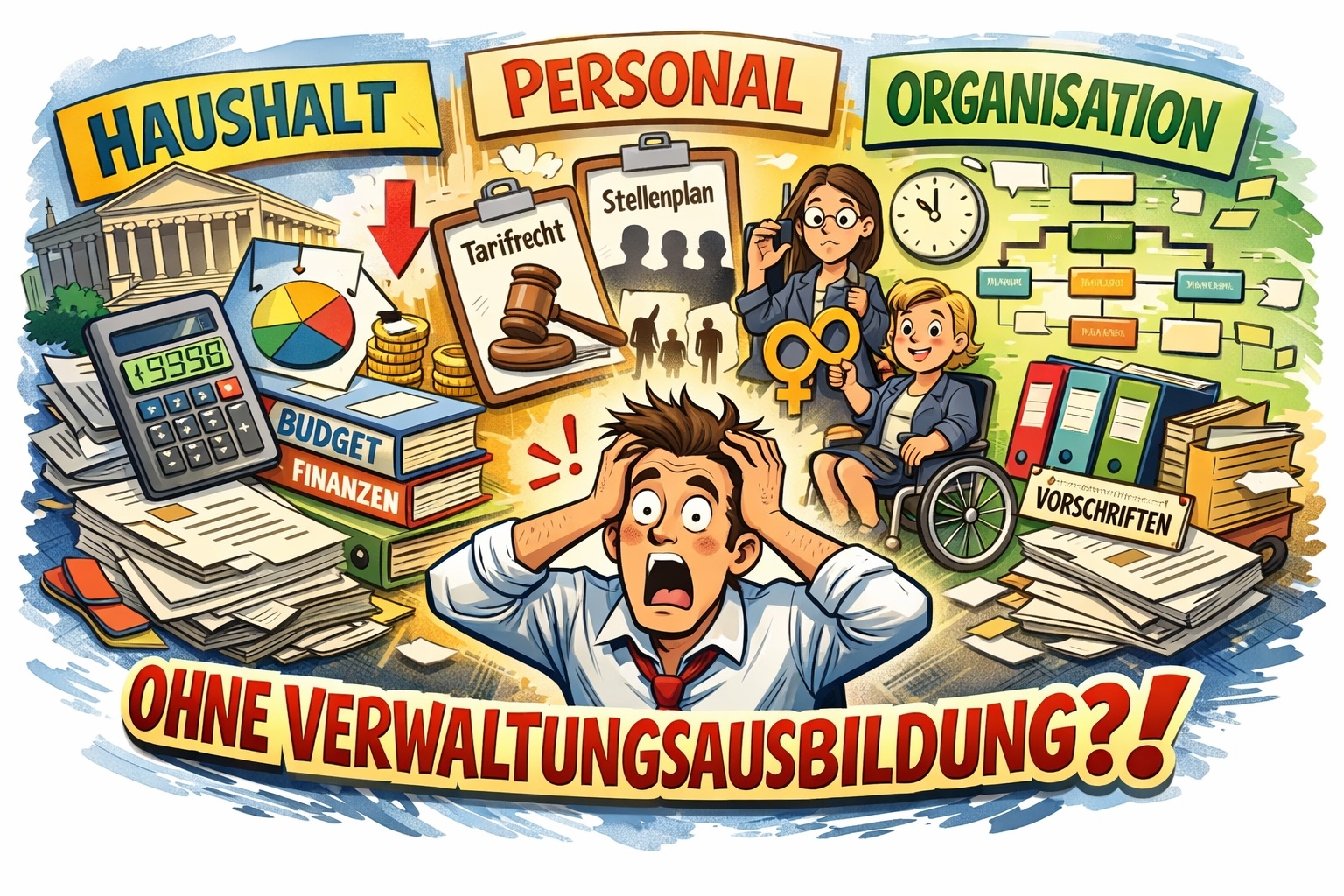Fehler im Vergabeverfahren sind für öffentliche Auftraggeber mehr als nur ein rechtliches Ärgernis – sie können erhebliche finanzielle Konsequenzen nach sich ziehen, insbesondere wenn Fördermittel betroffen sind. Doch wie ist mit solchen Vergabefehlern umzugehen? Ist der Widerruf der Zuwendung automatisch die Folge? Dieser Beitrag beleuchtet die komplexe Ermessensentscheidung, die Zuwendungsgeber im Spannungsfeld zwischen Zuwendungs- und Vergaberecht zu treffen haben.
Kein Automatismus: Die Rolle des Ermessens bei objektiven Vergabefehlern
Wird ein Vergabefehler objektiv festgestellt, etwa durch eine Prüfung oder eine gerichtliche Entscheidung, steht der Zuwendungsgeber vor der Frage, ob und in welchem Umfang er den Zuwendungsbescheid widerrufen muss. Dabei handelt es sich keineswegs um einen Automatismus. Vielmehr sieht das Haushalts- und Verwaltungsrecht eine Ermessensentscheidung vor: Die Behörde muss prüfen, ob sie den Bescheid ganz, teilweise oder gar nicht zurücknimmt. Hierbei kommt es insbesondere auf die Einzelfallumstände an – und genau hier liegt häufig der Kern rechtlicher Auseinandersetzungen.
Intendiertes Ermessen und Verwaltungspraxis
In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass das Ermessen beim Widerruf im Grundsatz „intendiert“ ist – also regelmäßig im Sinne eines Widerrufs auszuüben ist. Dies folgt aus den haushaltsrechtlichen Grundsätzen von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (vgl. OVG NRW, Urt. v. 15.08.2019 – 15 A 2792/18, BVerwG, Urt. v. 26.06.2002 – 8 C 30.01, VG Gießen, Urt. v. 11.12.2023 – 4 K 1641/22). Aber: Auch ein intendiertes Ermessen entbindet die Verwaltung nicht davon, die konkreten Umstände des Einzelfalls zu prüfen. Nur wenn kein Abweichungsfall vorliegt, kann auf eine ausführliche Begründung verzichtet werden.
Besondere Bedeutung kommt der gleichmäßigen Verwaltungspraxis zu. Behörden müssen sich an ihre eigenen Regeln halten – etwa in Form von Verwaltungsvorschriften, Erlassen oder EU-Leitlinien, die Rückforderungsmaßstäbe setzen. Allerdings genügt es nicht, sich pauschal auf diese Vorgaben zu berufen: Auch bei der Anwendung solcher Vorschriften müssen Ausnahmen erkannt und begründet werden, wenn sich der konkrete Fall vom Regelfall unterscheidet (vgl. VG München, Urt. v. 25.04.2024 – M 31 K 21.2797, OVG Schleswig-Holstein, Urt. v. 18.12.2020 – 5 LA 179/20, OVG Schleswig-Holstein, Urt. v. 23.08.2022 – S LB 9/20).
Die konkrete Ausgestaltung des Ermessens im Einzelfall
Die Entscheidung über das „Ob“ und das „Wie“ des Widerrufs muss sich an mehreren Kriterien orientieren. Drei zentrale Aspekte sind dabei besonders hervorzuheben:
1. Schwere des Verstoßes
Zentrales Kriterium ist die Schwere des Vergabeverstoßes. Dabei wird zwischen groben und rein formalen Fehlern differenziert. Hat der Verstoß keine nennenswerten Auswirkungen auf Wirtschaftlichkeit oder Sparsamkeit, etwa bei formalen Mängeln ohne Einfluss auf den Wettbewerb, kann ein Widerruf unverhältnismäßig sein. Die Einstufung der Schwere ergibt sich häufig aus den einschlägigen Verwaltungsvorschriften. Dass insbesondere bei formalen Verstößen ein Widerruf regelmäßig nicht angezeigt ist, wurde u. a. vom OVG Schleswig-Holstein, Urt. v. 18.12.2020 – 5 LA 179/20 bestätigt.
2. Subjektive Vorwerfbarkeit
Auch die subjektive Seite spielt eine Rolle: War der Verstoß für den Zuwendungsempfänger erkennbar? Oder bestand möglicherweise eine abweichende Rechtsauffassung? Wenn die Verwaltung selbst durch ihr Verhalten ein bestimmtes Vorgehen nahegelegt oder sogar bestätigt hat, kann ein späterer Widerruf gegen Treu und Glauben verstoßen (vgl. VG Gießen, Urt. v. 11.12.2023 – 4 K 1641/22, VG Köln, Urt. v. 21.11.2013 – 16 K 6287/11). Auch unbewusste Fehler müssen unter diesem Gesichtspunkt bewertet werden – insbesondere dann, wenn sie aus einer unklaren Rechtslage oder widersprüchlicher Beratung resultieren (vgl. OVG Münster, Urt. v. 15.08.2019 – 15 A 2792/18).
3. Weitere besondere Umstände
Zu berücksichtigen sind auch Faktoren wie die zeitliche Distanz zum Fehler oder die finanzielle Belastung durch eine Rückforderung – vor allem bei kleineren Zuwendungsempfängern. Ein unverhältnismäßiger Rückgriff auf lange zurückliegende Zuwendungen kann in solchen Fällen unbillig wirken und das Ermessensspiel verengen (vgl. OVG Schleswig-Holstein, Urt. v. 23.08.2022 – S LB 9/20).
Fazit: Die Einzelfallgerechtigkeit entscheidet
Die Feststellung eines objektiven Vergabefehlers ist in der Regel unproblematisch – die Herausforderung liegt in der daran anschließenden Ermessensentscheidung. Diese muss nicht nur rechtlich korrekt, sondern auch sachgerecht und verhältnismäßig sein. Dabei sind rechtliche Vorgaben, behördliche Praxis und Einzelfallumstände gleichermaßen zu berücksichtigen. Öffentliche Auftraggeber müssen deshalb besonders sorgfältig abwägen, um finanzielle Risiken zu minimieren und zugleich rechtssichere Entscheidungen zu treffen. Das Spannungsfeld zwischen Zuwendungs- und Vergaberecht verlangt Fingerspitzengefühl – und eine saubere juristische Begründung.
Wir unterstützen Sie gerne
Wenn Sie sich unsicher fühlen, was die vergaberechtlich korrekte Durchführung von Vergabeverfahren betrifft, kommen Sie gerne auf uns zu.
Wir bieten Ihnen und Ihren Mitarbeitenden Schulungen zu vergaberechtlichen Themen an sowie das Abwickeln Ihrer Ausschreibungen.
Kontaktieren Sie uns gerne unter
kontakt@optiso-consult.de oder
0176 54921673