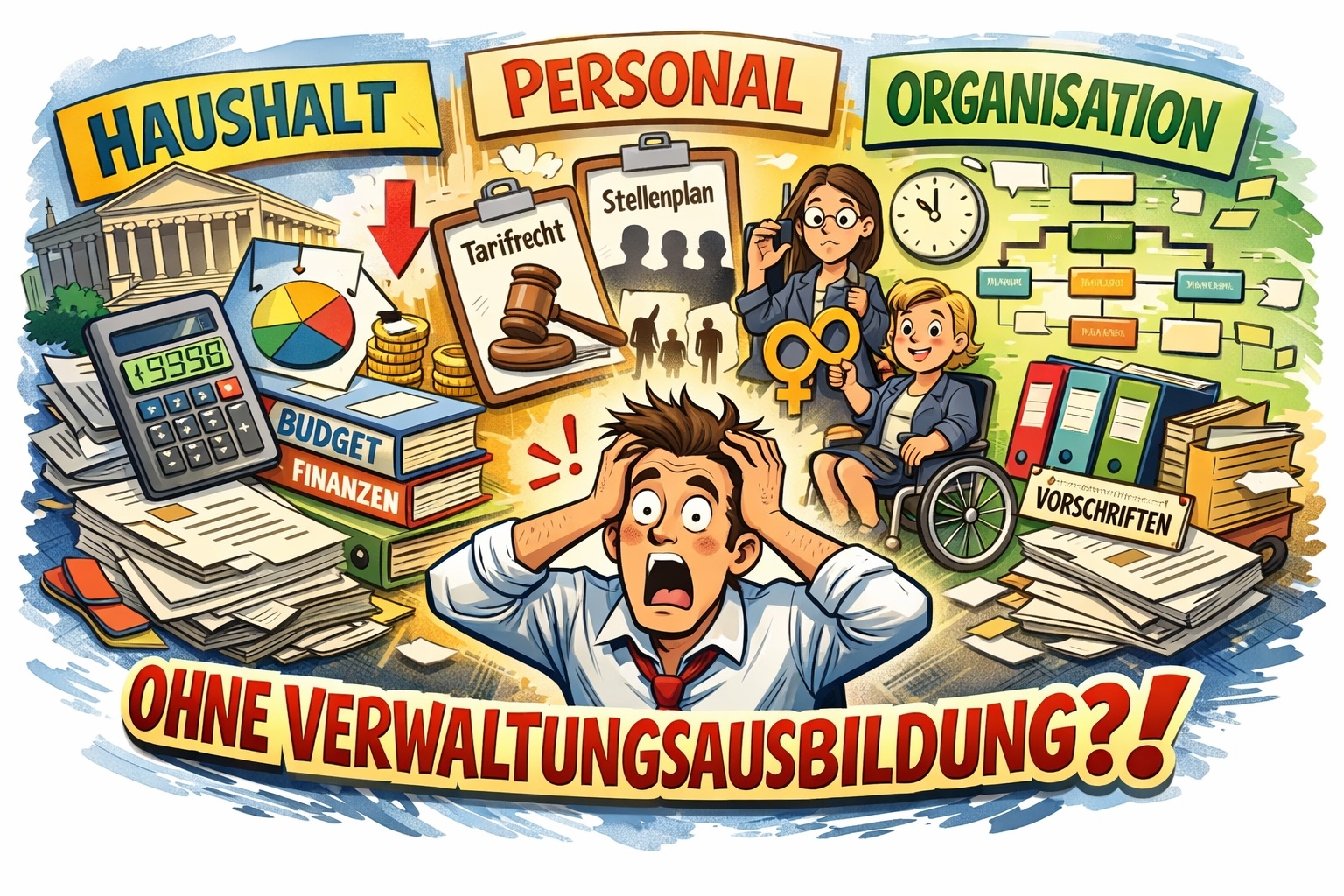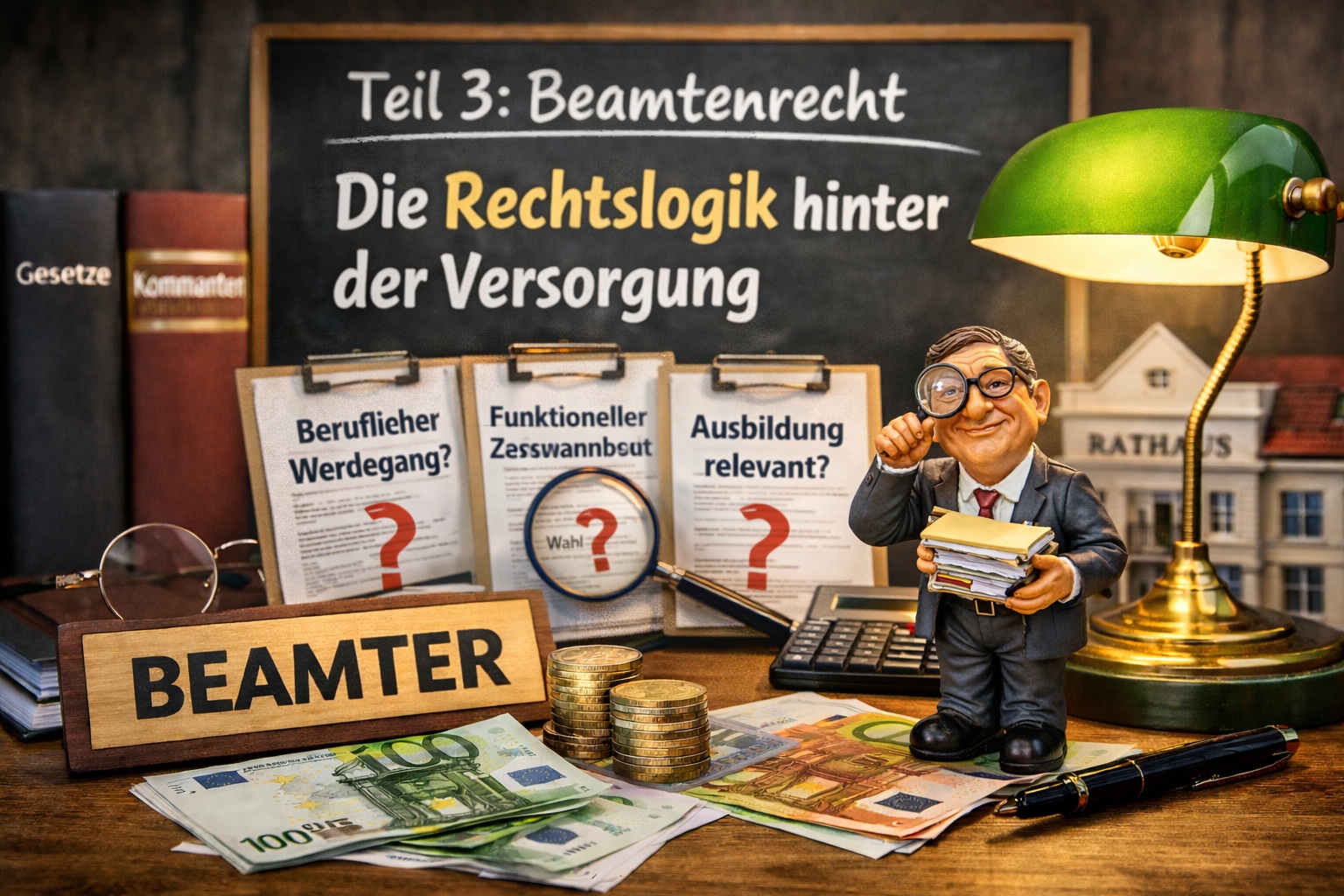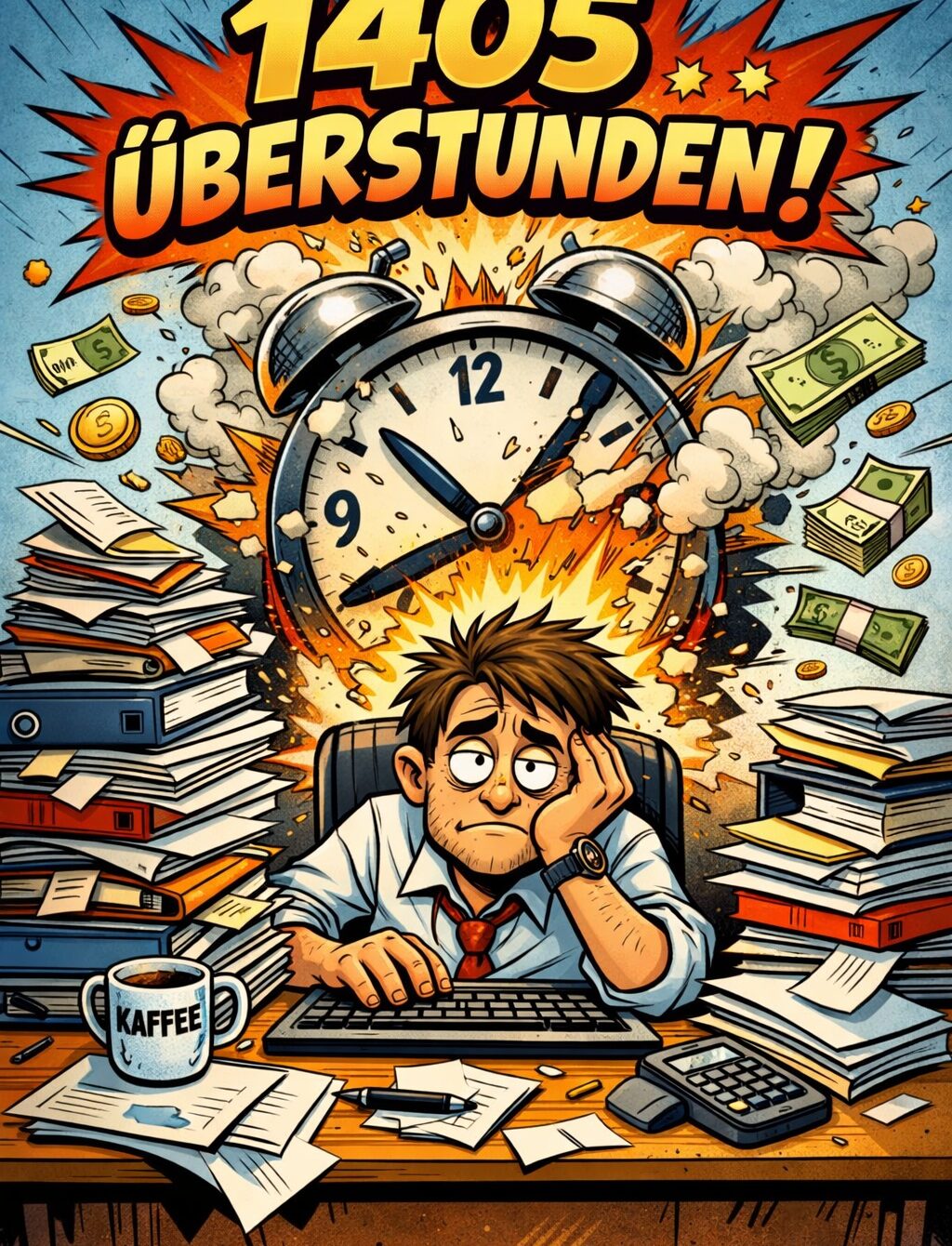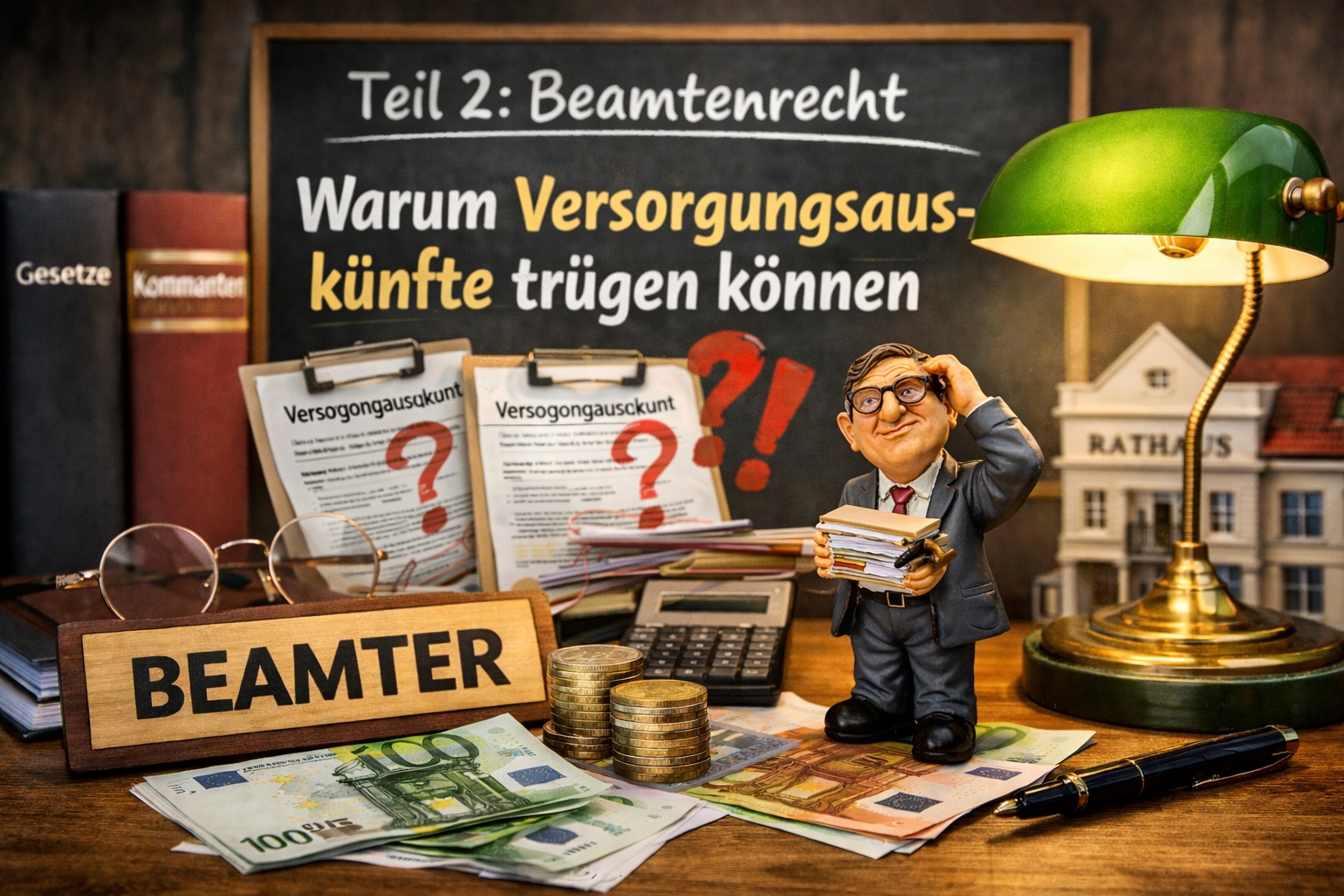Der Wechsel bzw. Einstieg in die erste Führungsrolle gehört zu den prägendsten Momenten einer beruflichen Laufbahn. Die Beförderung bringt Anerkennung, neue Gestaltungsspielräume und gleichzeitig einen hohen Erwartungsdruck.
Insbesondere jüngere Führungskräfte tun sich häufig schwer mit ihrer Rolle. Dieser Beitrag beleuchtet fünf klassische Fehler – und wie sie vermieden werden können.
Fehler 1: Weiterarbeiten wie bisher
Viele neue Führungskräfte behalten ihren alten Arbeitsstil bei. Sie erledigen weiterhin operative Aufgaben, springen bei jeder Kleinigkeit ein und verlieren dabei die eigentlichen Führungsaufgaben aus dem Blick.
Die Folge
Die Führungskraft bleibt zu sehr vom Tagesgeschäft vereinnahmt und vernachlässigt die strategischen Führungsaufgaben. Dadurch bleibt das Team orientierungslos und wichtige Entwicklungen werden verpasst.
Was hilft?
Der bewusste Wechsel vom „Mitarbeitenden“ zum „Führenden“ – zum Beispiel durch professionelle Delegation von operativen Aufgaben an Mitarbeitende. Das schafft Freiraum für strategische Themen. Eine weitere Möglichkeit sind regelmäßige Mitarbeitergespräche. Diese können genutzt werden, um konstruktives Feedback zu geben und den Rahmen für die zukünftigen Aufgaben abzustecken.
Fehler 2: Der verlängerte „Kumpelmodus“
Gerade bei internen Beförderungen ist dies häufig zu beobachten. Die Führungskraft nimmt die neue Rolle nicht vollständig an und will „eine von ihnen“ bleiben. Aus Angst vor Konflikten oder Unbeliebtheit wird dann Autorität vermieden und Entscheidungen immer wieder vertagt.
Die Folge
Unklarheit, fehlende Orientierung und ein Führungsvakuum, in dem Missverständnisse und Konflikte unter der Oberfläche gären.
Was hilft?
Eine offene Kommunikation über die neue Rolle und klare Absprachen. Hierzu kann man gemeinsam mit dem Team Verantwortlichkeiten und Entscheidungsbefugnisse genau definieren. Diese müssen dann natürlich klar eingehalten werden. Darüber hinaus sollte die Führungskraft konsequent die eigenen Entscheidungen treffen und zu diesen stehen. Nähe und Führung schließen sich dabei nicht aus, solange die Rollengrenzen transparent sind.
Fehler 3: Entscheidungsschwäche aus Unsicherheit
Entscheidungen werden hinausgezögert, um es allen recht zu machen. Führung wird – in der Absicht, das Team einzubinden – häufig vermieden.
Die Folge
Wenn Entscheidungen ausbleiben, wird Handlungsfähigkeit blockiert. Das bedeutet, dass sich Projekte verzögern, Unklarheit über die Zukunft herrscht und das Vertrauen in die Führung schwindet.
Was hilft?
Klare Entscheidungen müssen auch unter Unsicherheit betroffen werden. Nicht die perfekte Lösung zählt, sondern die Fähigkeit, handlungsfähig zu bleiben und Verantwortung zu übernehmen. Dabei kann die Führungskraft sehr gut für Verständnis und Akzeptanz sorgen, indem die Gründe für die klaren Entscheidungen dem Team transparent erklärt werden. Im nächsten Schritt kann man noch Rückmeldungen des Teams aktiv einfordern und nutzen, um Entscheidungen zu reflektieren und gegebenenfalls anzupassen.
Fehler 4: Vermeidung von Feedback
Aus Sorge, andere zu verletzen oder als überheblich zu gelten, wird auf kritisches Feedback verzichtet. Doch damit erreicht man oft genau das Gegenteil.
Die Folge
Ohne Feedback entstehen „blinde Flecken“ bei den Mitarbeitenden. Leistungsprobleme werden nicht angesprochen und Missverständnisse sind vorprogrammiert. Langfristig stagniert sowohl die Entwicklung des Einzelnen sowie des gesamten Teams.
Was hilft?
Das Führen regelmäßiger Feedbackgespräche, um Entwicklung zu fördern und Missverständnisse zu klären. Dabei ist darauf zu achten, dass das Feedback konkret konstruktiv und respektvoll gegeben wird. Dadurch wird mit der Zeit eine Atmosphäre geschaffen, in der Feedback als Chance zur Weiterentwicklung gesehen wird. Und wichtig: Das Loben nicht vergessen.
Fehler 5: Keine Unterstützung annehmen
Viele glauben, sie müssten als Führungskraft plötzlich alles wissen. Fragen gelten als Schwäche, Fehler als Scheitern. Das führt zwangsläufig zur Isolierung.
Die Folge
Das Risiko von Fehleinschätzungen steigt deutlich und langfristig droht die Gefahr der Überforderung.
Was hilft?
Die Bereitschaft, sich Unterstützung zu holen. Das kann zum Beispiel durch den vertrauensvollen Austausch mit anderen Führungskräften geschehen. Unterstützen können zudem externe Angebote wie Business Coaching und Beratung.
Den Übergang in die Führung meistern
Das Dasein als frischgebackene Führungskraft verlangt eine bewusste Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle, klare Kommunikation und die Bereitschaft, neue Kompetenzen zu entwickeln. In der Übergangsphase sind zahlreiche Herausforderungen zu meistern. Doch durch bewusste Reflexion, klare Kommunikation und die Bereitschaft, Unterstützung anzunehmen, können neue Führungskräfte ihre Rolle souverän gestalten und erfolgreich ausfüllen.
Wer sich auf diesen Prozess einlässt, kann nicht nur fachlich, sondern auch persönlich enorm wachsen. Wichtig ist auch, dass ein Vertrauensverhältnis innerhalb des zu führenden Teams vorliegt und die Person die Kompetenz besitzt, neue Perspektiven zu eröffnen, sowie dabei helfen kann, mögliche blinde Flecken zu erkennen. So können frische Führungskräfte nicht nur ihre Rolle souverän gestalten, sondern auch die Sicherheit und Klarheit gewinnen, die für langfristigen Erfolg entscheidend sind.