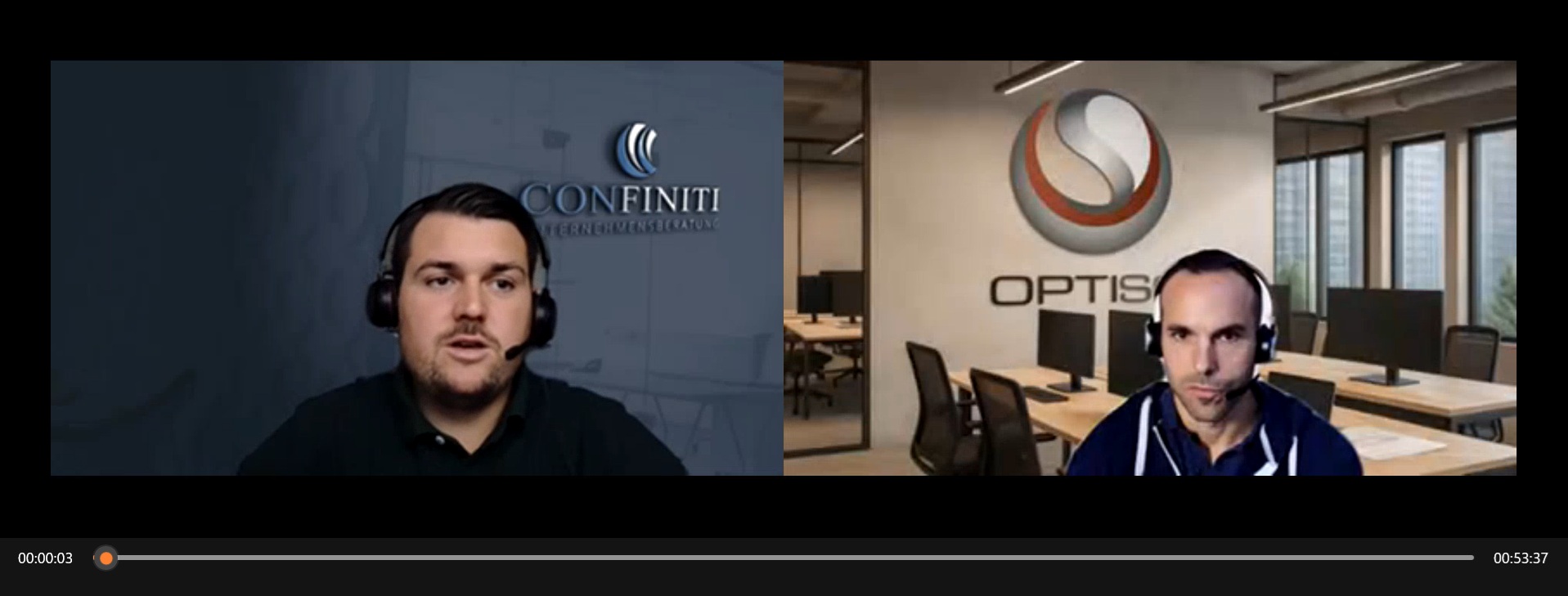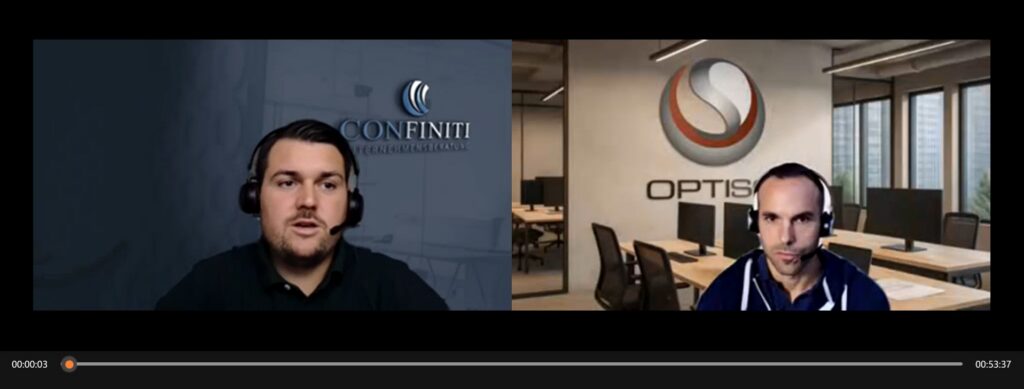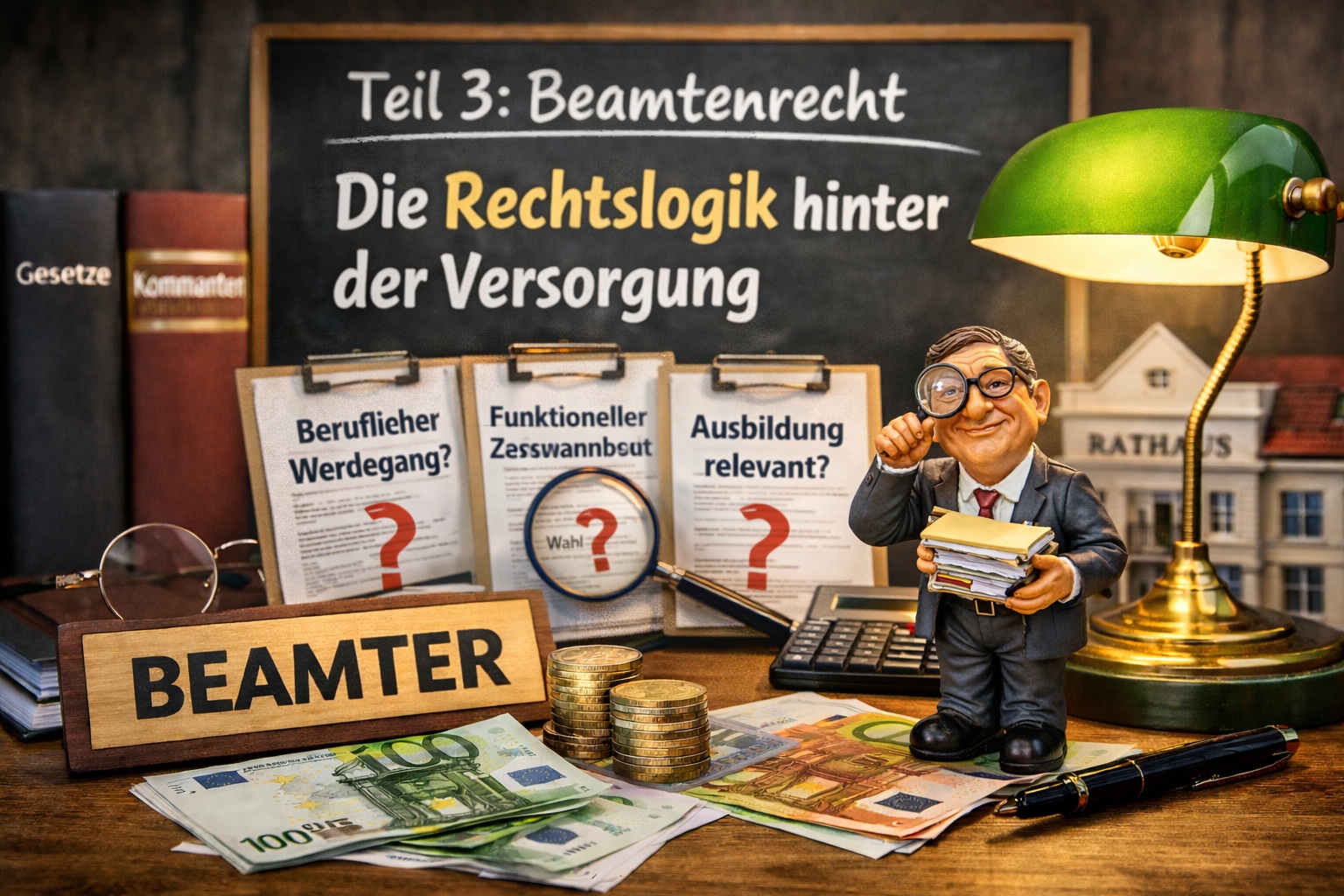Vorab: Hier ist das Video zum Blogbeitrag:
Ein Gespräch über Chancen, Herausforderungen und die Zukunft des öffentlichen Dienstes
Künstliche Intelligenz (KI) ist längst nicht mehr nur ein Hype-Thema. Auch in Kommunen wird sie zunehmend diskutiert und eingesetzt. In einem spannenden Austausch zwischen Dino Schubert (OptiSo) und Tobias Tennert (Confinity) wurde deutlich: KI hat das Potenzial, die Arbeitsweise von Verwaltungen grundlegend zu verändern – vorausgesetzt, die Basis stimmt.
KI als Aufgabenveränderer, nicht Jobkiller
Eines der Kernargumente: KI bedroht keine Arbeitsplätze, sondern verändert Aufgaben. In der öffentlichen Verwaltung herrscht heute schon ein massiver Personalmangel. KI kann helfen, Routineaufgaben zu automatisieren und Mitarbeitende so zu entlasten, damit sie sich stärker auf komplexe, menschzentrierte Aufgaben konzentrieren können.
„Es geht nicht darum, Stellen abzuschaffen, sondern darum, die Fülle an Aufgaben überhaupt noch bewältigen zu können“, so Schubert.
Anwendungsfelder: Von Pressearbeit bis Voicebot
Viele Verwaltungen nutzen KI bereits heute – wenn auch oft noch unreguliert:
- Öffentlichkeitsarbeit: Texte für Webseiten oder Pressemitteilungen.
- Personalprozesse: erste Entwürfe für Abmahnungen oder Verträge.
- Bürgerkommunikation: Übersetzungs-Tools oder Voicebots im Bürgercenter.
Solche „Low Hanging Fruits“ schaffen unmittelbaren Mehrwert, senken Hürden für Bürger*innen und steigern die Akzeptanz von KI in der VerwaltungKI Nutzung Kommune _ Aufzeichnu….
KI ist nicht gleich Automatisierung
Wichtig ist die klare Unterscheidung:
- Prozessautomatisierung (RPA): folgt festen Regeln (z. B. eingescannte Dokumente automatisch zuordnen).
- Künstliche Intelligenz (LLMs, Chatbots): arbeitet probabilistisch, lernt aus Daten und kann flexibler reagieren.
Diese Differenzierung sei entscheidend, um Verwaltungen nicht in überhöhte Erwartungen oder falsche Investitionen laufen zu lassen.
Ohne Projektmanagement und Change-Kompetenz keine Digitalisierung
Ein wiederkehrender Befund: Viele Kommunen springen direkt in KI-Projekte, ohne grundlegende Strukturen geschaffen zu haben. Fehlendes Projektmanagement, unklare Ziele und nicht standardisierte Prozesse bremsen die Einführung.
KI-Einführung ist nicht nur Technik, sondern vor allem Organisations- und Kulturwandel.
Hier spielen Rollen wie KI-Architekt oder Projektleiter eine Schlüsselrolle – weniger als Techniknerds, sondern vielmehr als Generalisten mit Kommunikations- und Change-Kompetenz.
Kulturwandel und Akzeptanz
Verwaltungen sind traditionell hierarchisch organisiert. Projektarbeit und der Einsatz von KI durchbrechen diese Strukturen und fordern ein neues Mindset.
Ein Ansatz: Botschafter in der Organisation, die als Multiplikatoren für das Thema fungieren und Ängste abbauen. Denn viele Mitarbeitende fürchten, dass KI ihre Arbeit ersetzt. Stattdessen sollte betont werden: KI rationalisiert Aufgaben, nicht Jobs.
Blick nach vorn: Wie sieht die Kommune 2030 aus?
Die Gesprächspartner wagen auch einen Blick in die Zukunft:
- Chatbots und Voicebots werden Standard in Bürgerämtern sein.
- On-Premise-Lösungen wie „LL Moin“ (Niedersachsen) bieten sichere Alternativen zu US-Plattformen.
- Super-Intelligenzen oder humanoide Roboter in Kommunen könnten erste Pilotfälle sein – wenn Kultur und Akzeptanz mithalten.
Kommunen, die KI nicht nutzen, laufen Gefahr, den Anschluss endgültig zu verlieren.
Fazit
Künstliche Intelligenz in Kommunen ist mehr als nur Technologie. Sie ist Aufgabenveränderer, Kulturthema und Motor für Modernisierung. Entscheidend sind ein klares Projektmanagement, transparente Kommunikation und eine Strategie, die mit konkreten Anwendungsfällen beginnt.
Oder wie es im Gespräch treffend hieß: „KI sorgt dafür, dass wir auch morgen noch unsere Aufgaben bewältigen können – für Bürger und Mitarbeitende gleichermaßen.“
Im nächsten Beitrag wird es um Change- und Projektmanagement-Kompetenz als Schlüssel zur digitalen Verwaltung gehen.