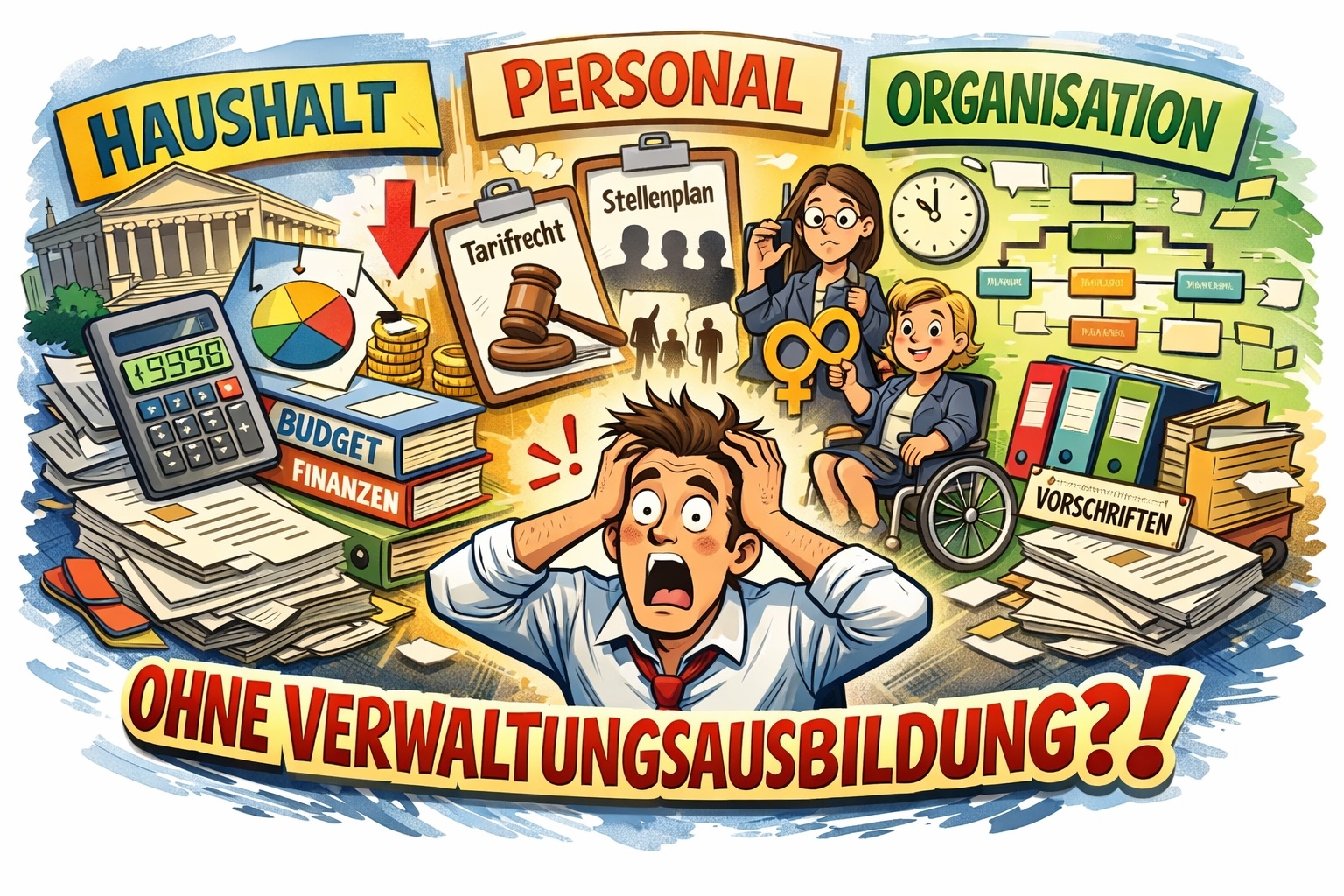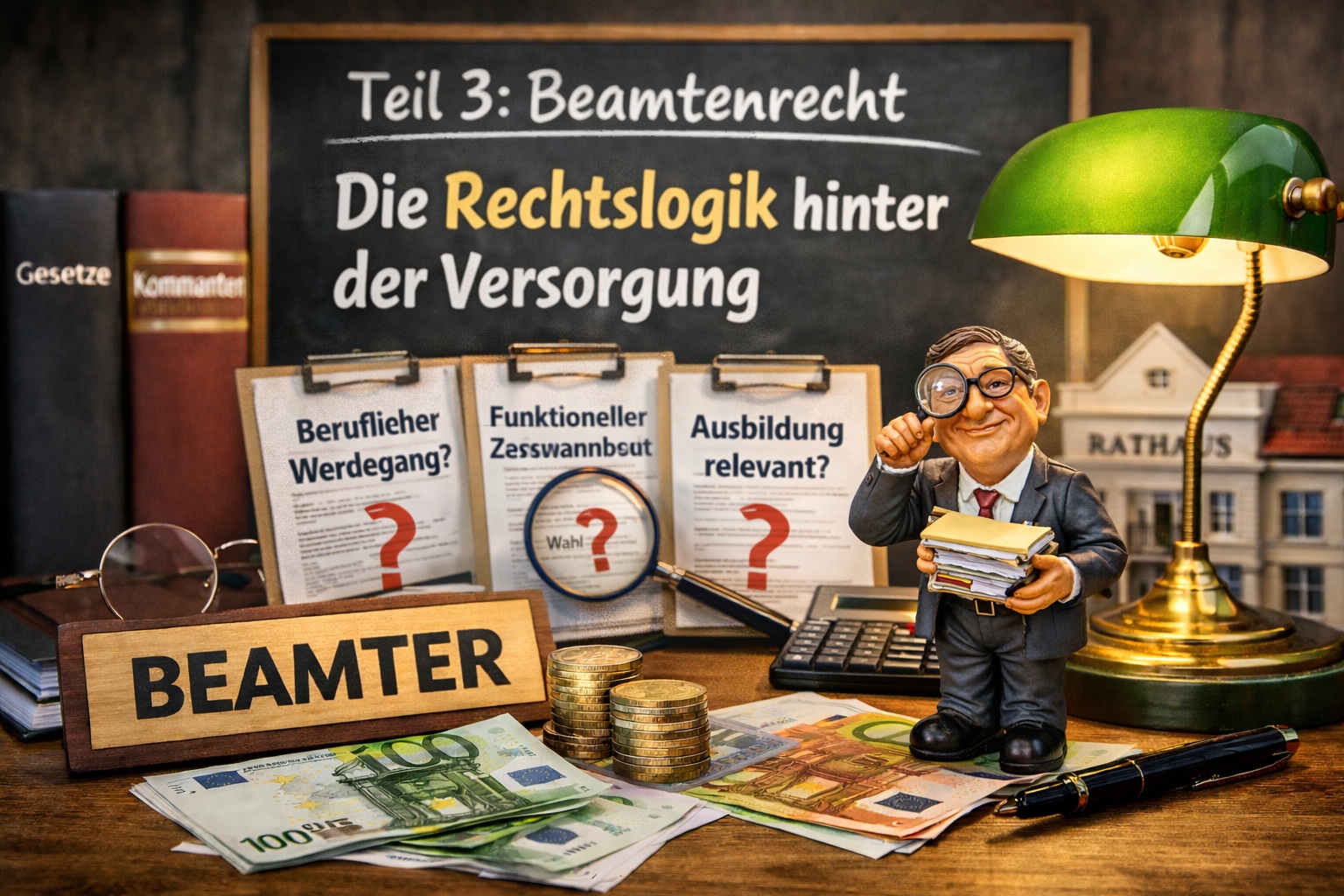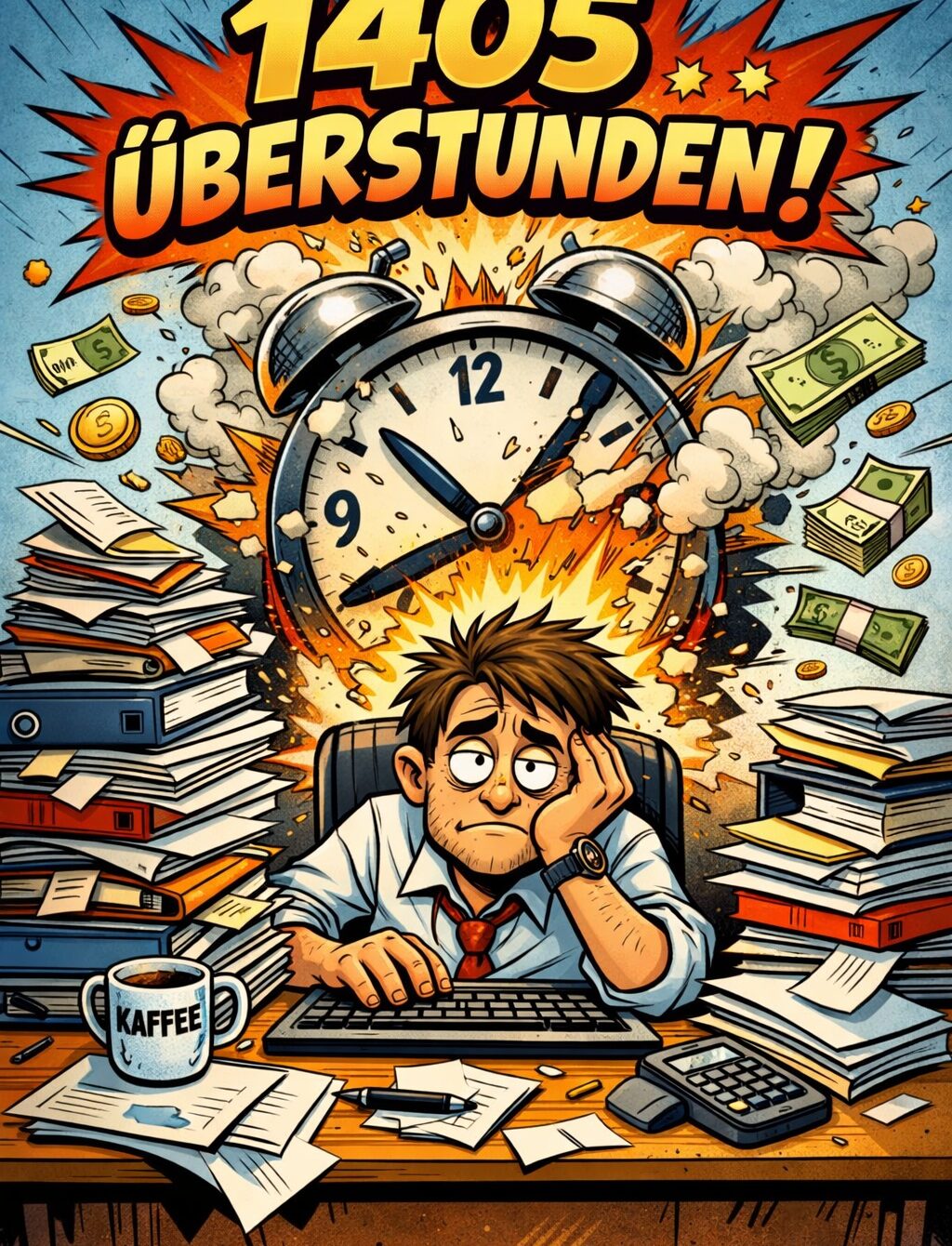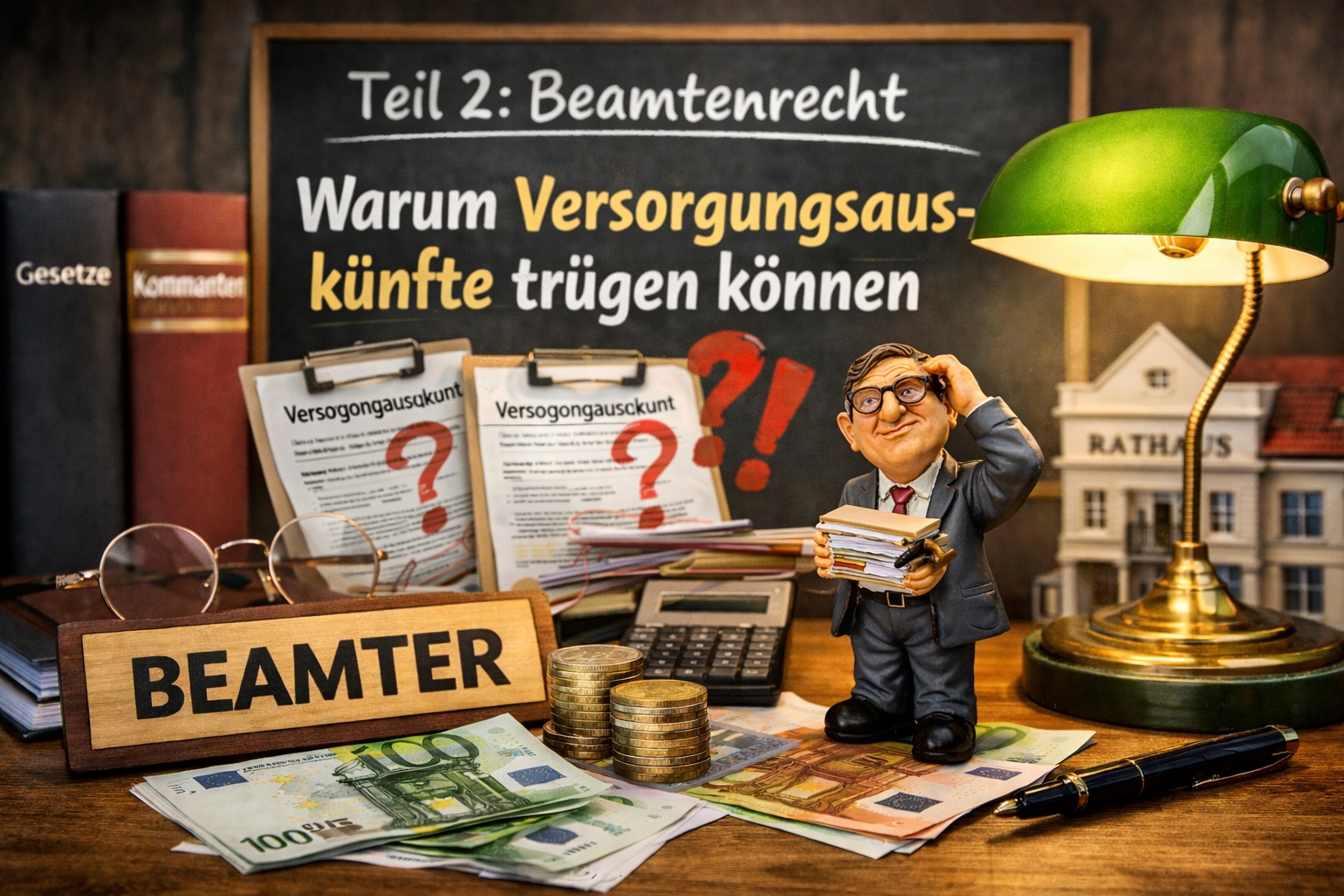Ein Brandmeisteranwärter muss die Kosten für eine 18-monatige Ausbildung zum Brandmeister trotz vorzeitigem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis nicht zurückzahlen. Das Landesarbeitsgericht (LAG) Köln entschied, dass die entsprechenden Klauseln in einer Fortbildungsvereinbarung unwirksam waren (Urteil vom 19. August 2025, 7 SLa 647/24).
Der Fall: Rückzahlungsvereinbarung im Fortbildungsvertrag
Der Arbeitnehmer schloss mit seinem früheren Arbeitgeber im Februar 2022 einen Arbeitsvertrag, wodurch er ab 01. April 2022 als Brandmeisteranwärter in der Abteilung Brandschutz eingestellt wurde. Gleichzeitig schloss er eine sog. Fortbildungsvereinbarung ab, in der der Arbeitgeber sich verpflichtete, den Beschäftigten für die Zeit einer Fortbildung zum Feuerwehrmann/Brandmeister freizustellen und die Kosten zu übernehmen.
In dem Arbeitsvertrag wurde auch eine Rückzahlungsverpflichtung festgehalten. Diese würde greifen, wenn das Arbeitsverhältnis innerhalb von drei Jahren (36 Monate) nach erfolgreicher Beendigung der Fortbildung aus vom Arbeitnehmer zu vertretenden Gründen von diesem selbst, dem Arbeitgeber oder im gegenseitigen Einvernehmen auf Veranlassung des Arbeitnehmers beendet wird.
Zudem hat sich der Beschäftigte verpflichtet, die vom Arbeitgeber während der Freistellung gezahlte (Bruttomonats-)Vergütung – ohne Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung – ganz oder teilweise an diesen zurückzuzahlen.
Der Arbeitnehmer führte die 18-monatige Ausbildung erfolgreich; das Arbeitsverhältnis kündigte er dann ohne Angabe von Gründen ordentlich zu Ende Februar 2024.
Arbeitgeber verlangt Rückzahlung nach vorzeitiger Kündigung
Im März 2024 forderte der Arbeitgeber daraufhin anteilige Fortbildungskosten in Höhe von rund 70.000 Euro von seinem ehemaligen Beschäftigten zurück. Dieser verweigerte jedoch die Zahlung. Als Begründung führte er an, dass die in der Fortbildungsvereinbarung enthaltenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) unwirksam seien, da sie zu einem wirtschaftlichen Ruin führen würden. Der Arbeitgeber habe sich zudem mehrfach nicht vertragsgetreu verhalten und somit die Kündigung zu verantworten. Beispielsweise habe er das Gehalt verspätet gezahlt.
Die erste Instanz, das Arbeitsgericht Siegburg, wies die Zahlungsklage ab. Dies begründete das Gericht damit, dass die Rückzahlungsvereinbarung einer AGB-Kontrolle nicht standhalte. Insbesondere sei der Arbeitnehmer dadurch unangemessen benachteiligt, dass auch eine Rückzahlungspflicht bestehe, wenn eine zur Kündigung führende Leistungsunfähigkeit auf einer einfachen Fahrlässigkeit des Arbeitnehmers beruhe.
LAG Köln: Rückzahlungsklausel benachteiligt Beschäftigten unangemessen
Auch das LAG Köln entschied, dass der Arbeitnehmer nicht zur Rückzahlung der geforderten Kosten verpflichtet sei. Der Arbeitgeber habe weder einen Anspruch auf Rückzahlung der Ausbildungskosten noch auf die während der Ausbildung gezahlte Vergütung. Entscheidend war nach Ansicht des Gerichts aber nicht, dass der Arbeitgeber die Kündigung des Beschäftigten zu verantworten hatte. Auch wenn der Arbeitgeber das Gehalt unstrittig zweimal in Folge zu spät überwiesen habe, seien die Gehaltsrückstände zum Kündigungszeitpunkt ausgeglichen gewesen.
Keine Rückzahlungspflicht aufgrund unwirksamer Rückzahlungsklausel
Bei den vorformulierten Regelungen im Fortbildungsvertrag handelte es sich um Allgemeine Geschäftsbedingungen, wie das LAG Köln feststellte. Die Rückzahlungsklausel benachteilige den Arbeitnehmer unangemessen i. S. d. § 307 Abs. 1 S. 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), ebenso wie die Rückzahlungsverpflichtung mit der Folge, dass sie unwirksam seien.
In seiner Begründung führte das LAG Köln aus, dass das billigenswerte und rechtlich anzuerkennende Interesse eines Arbeitgebers an einer Rückzahlungsverpflichtung darin bestehe, zu verhindern, dass der Arbeitnehmer sich eine teure Ausbildung finanzieren lässt und nach deren Abschluss aus freien Stücken ohne triftigen Grund das Arbeitsverhältnis beendet und schlimmstenfalls noch zu einem Konkurrenten wechselt. Nur darauf dürfe sich die Formulierung einer Rückzahlungsverpflichtung beziehen, sonstige Gründe für eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses dürften nicht zu einer Rückzahlungsverpflichtung führen.
Nach Auslegung des Gerichts umfasste der Begriff „vertreten müssen“ in der Rückzahlungsvereinbarung alle Gründe, die aus der jeweiligen Verantwortungs- und Risikosphäre des Beschäftigten stammen. Danach war die Rückzahlungsklausel unangemessen benachteiligend. Auch wenn man den Begriff so verstehe, dass der Arbeitnehmer Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten habe, genüge dies für die Unwirksamkeit der Klausel. Eine Rückzahlungsklausel sei auch dann unangemessen benachteiligend, wenn sie einen Beschäftigten zur Rückzahlung verpflichtet, der das Arbeitsverhältnis vor Ablauf der Bindungsdauer kündigt, weil es ihm beispielsweise aufgrund eines durch eigene Fahrlässigkeit verursachten Unfalls nicht mehr möglich ist, die geschuldete Arbeitsleistung zu erbringen.
Falsche Freistellung
Die Rückzahlungsklausel war aus mehreren Gründen unwirksam. Schon der Begriff „Freistellungsvergütung“ sei nicht richtig, rügte das Gericht, da es sich um eine Vergütung für geleistete Arbeit i. S. d. § 611a Abs. 2 BGB gehandelt habe. Der Arbeitnehmer war vorliegend als Brandmeisteranwärter, folglich als ein Auszubildender, eingestellt. Arbeitsvertraglich geschuldete Arbeitsleistung sei es somit gewesen, eine Ausbildung zum Brandmeister zu durchlaufen, was er auch getan habe. Eine erbrachte Arbeitsleistung als Freistellung zu deklarieren, um dann die Freistellungsvergütung zurückfordern zu können, sei nicht nur unangemessen benachteiligend, sondern verstoße auch gegen gesetzliche Bestimmungen wie § 611a Abs. 2 BGB, §§ 2, 3 Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) oder §§ 1, 11 Bundesurlaubsgesetz (BUrlG).
Die Pflicht zur Erstattung der Kosten in der geforderten Höhe von 70.000 Euro sei dem Arbeitnehmer zuletzt auch nach Treu und Glauben nicht zuzumuten. Der Beschäftigte gehe zurecht davon aus, dass die Klausel seinen wirtschaftlichen Ruin bedeutet hätte und damit unangemessen benachteiligend sei.
Die Revision an das Bundesarbeitsgericht (BAG) wurde wegen der grundsätzlichen Bedeutung zugelassen.