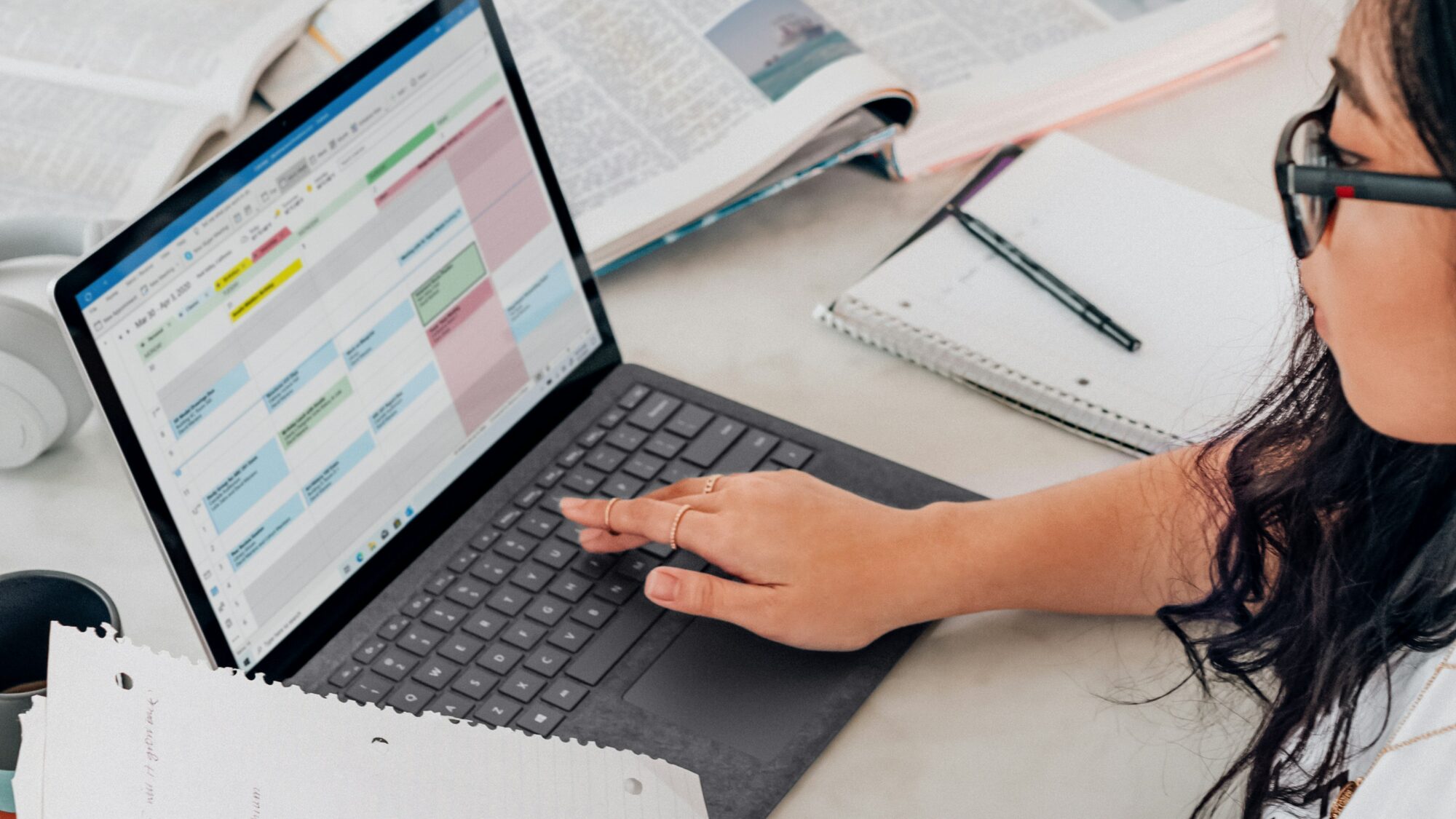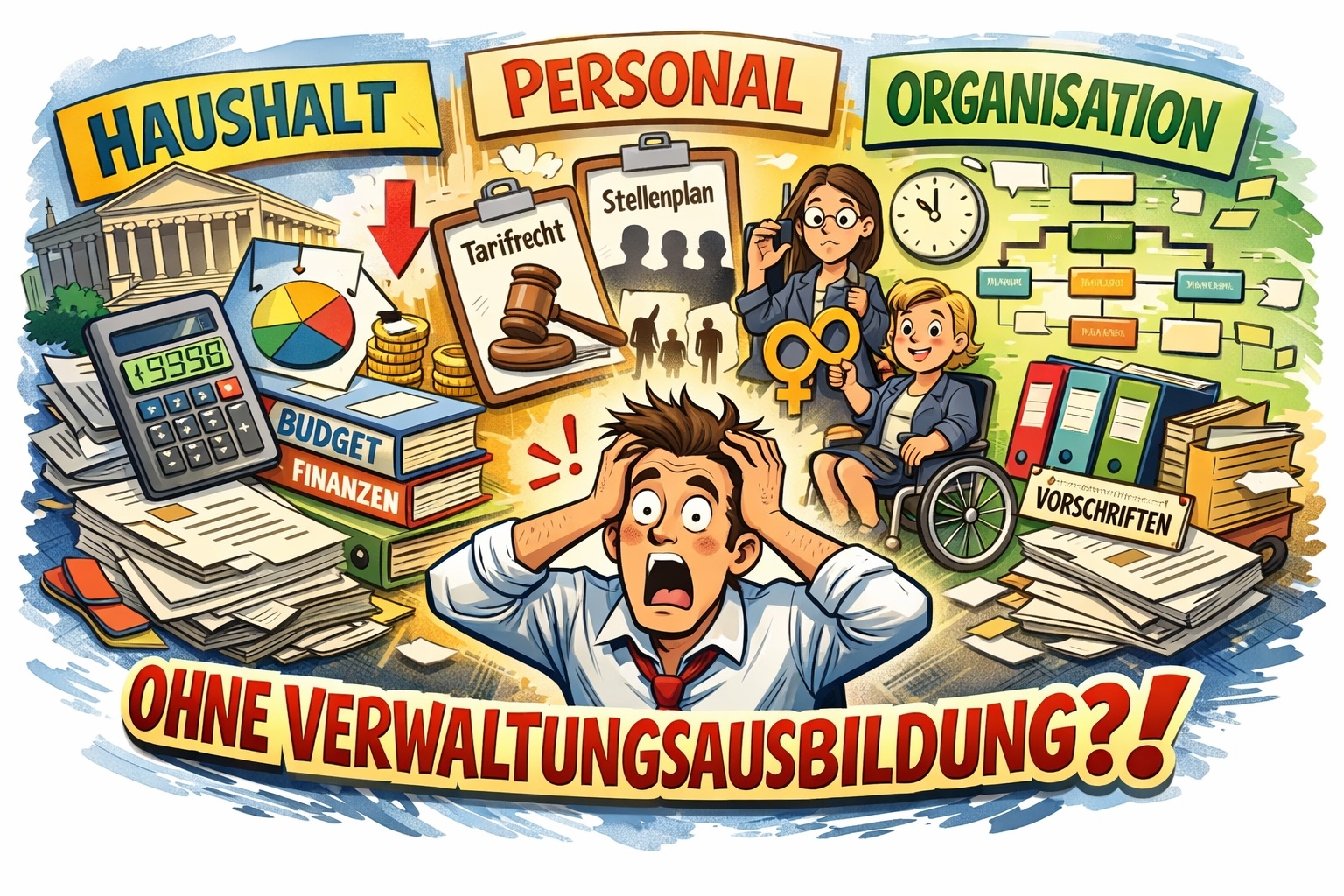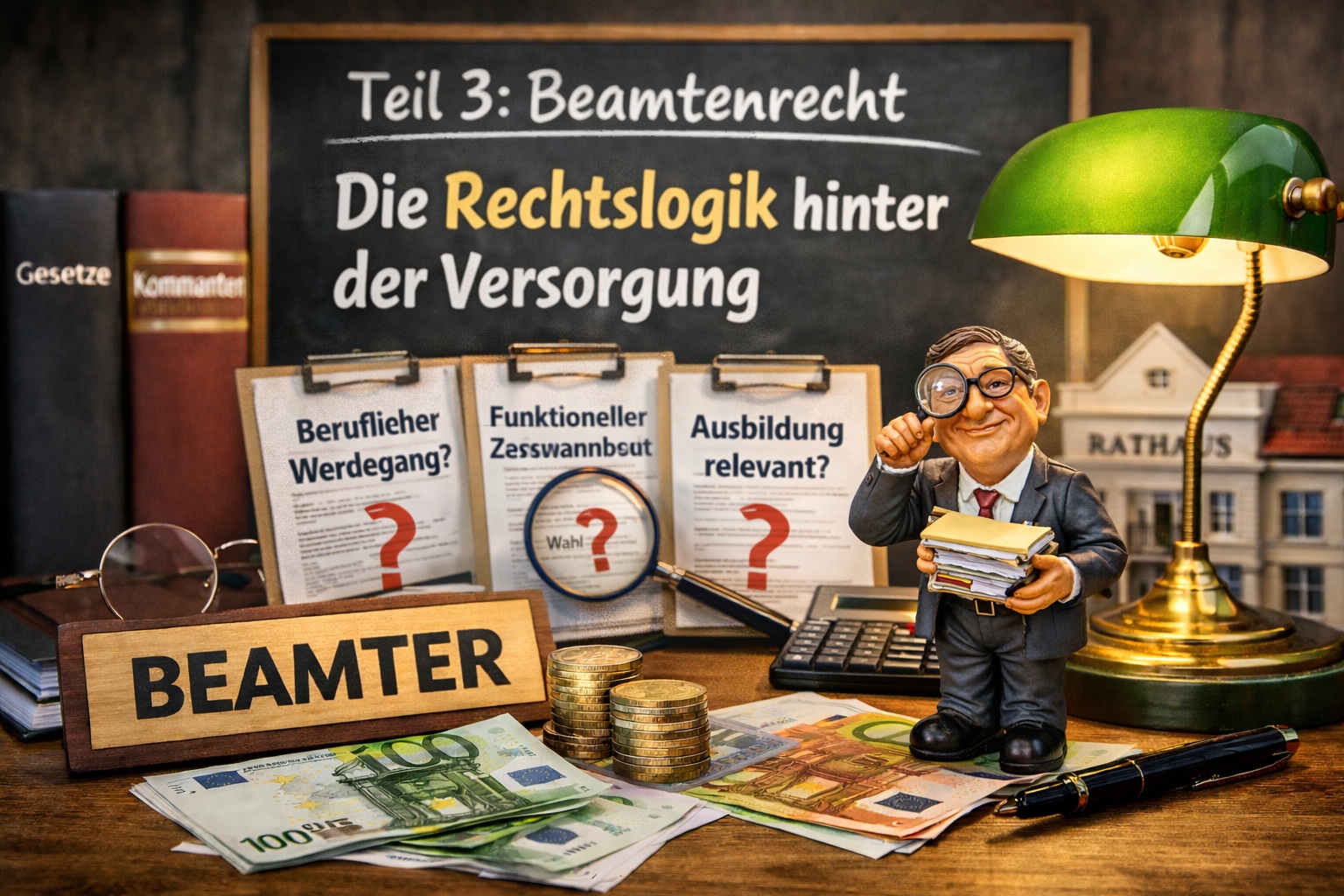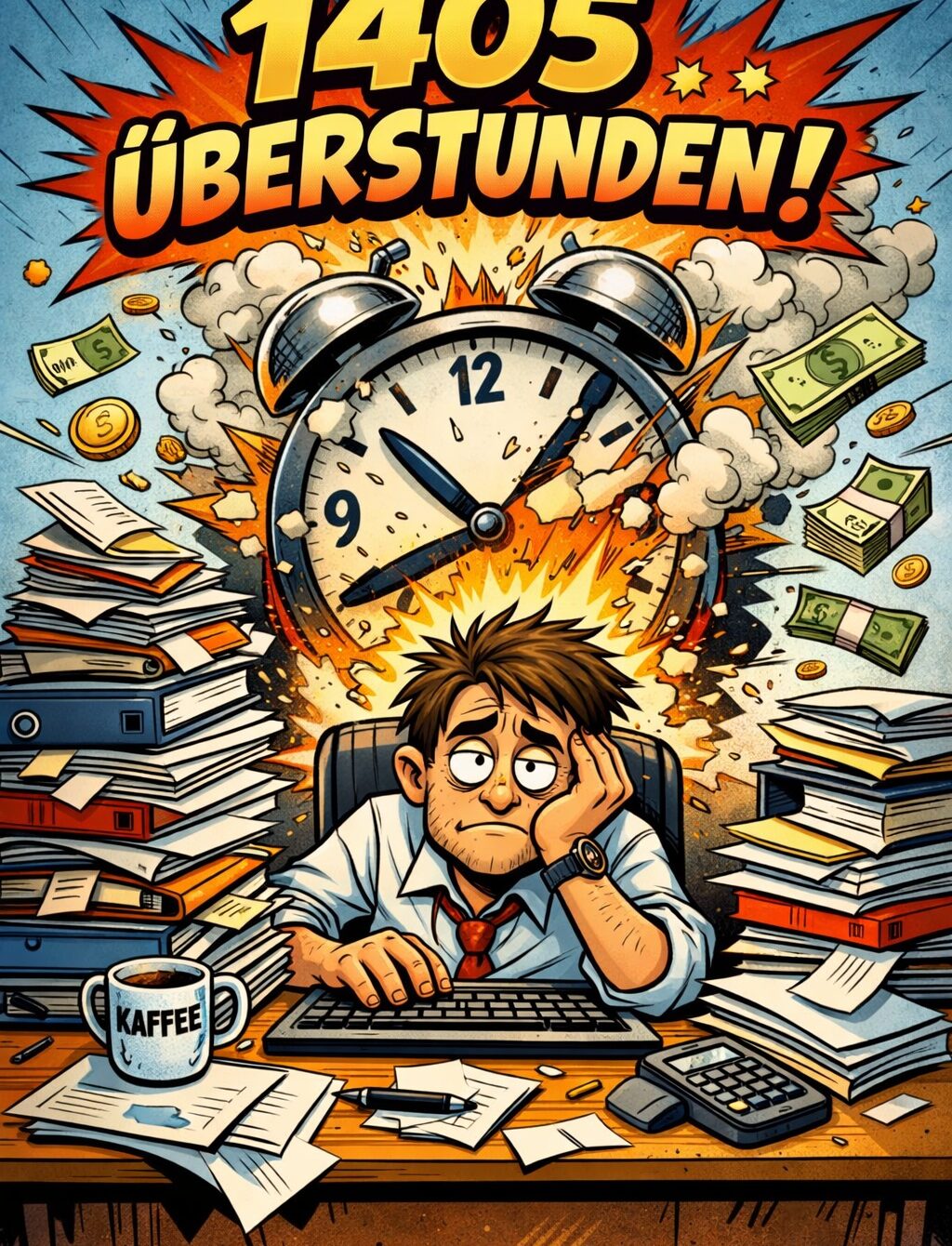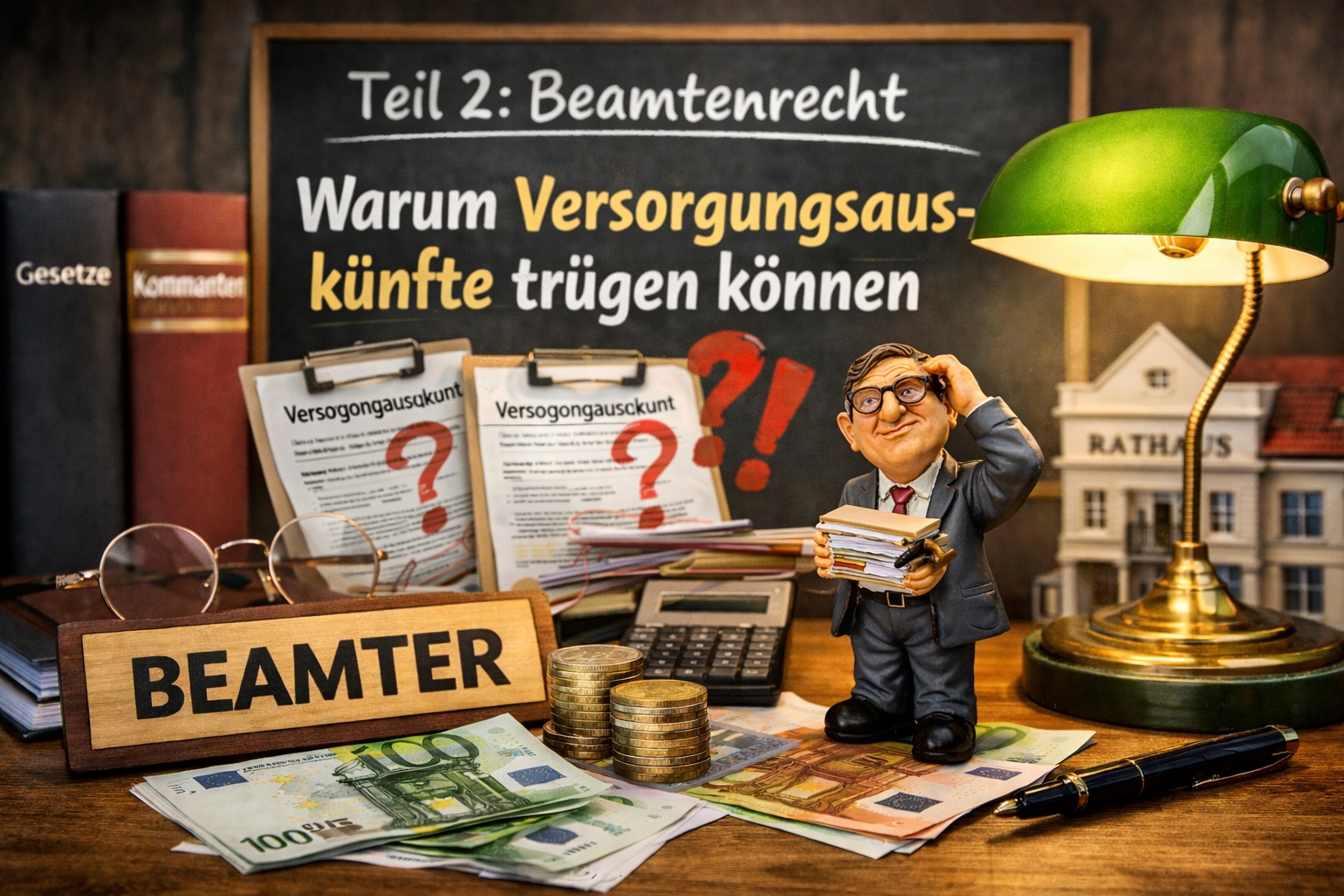Artikel 33 Absatz 2 des Grundgesetzes garantiert Deutschen den gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern, basierend auf Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung. Diese Regelung wird klassischerweise auf Behörden angewendet, doch auch privatrechtlich organisierte Institutionen, wie GmbHs oder Vereine, die hoheitliche Aufgaben übernehmen, unterliegen diesem Grundsatz. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat in seinem Urteil vom 12. April 2016 (9 AZR 673/14) diese Reichweite verdeutlicht und damit wichtige Leitlinien geschaffen.
Der Fall
Im zugrunde liegenden Fall ging es um eine privatrechtlich organisierte Einrichtung, die im Auftrag des Staates hoheitliche Aufgaben wahrnahm. Die Klägerin argumentierte, dass sie diskriminiert worden sei, da ihre Bewerbung nicht auf Grundlage von Eignung, Befähigung und Leistung beurteilt worden war. Das BAG stellte klar, dass Artikel 33 Abs. 2 GG auch auf juristische Personen des Privatrechts anwendbar ist, wenn diese öffentliche Aufgaben, insbesondere im Rahmen der Daseinsvorsorge übernehmen, die normalerweise dem Staat vorbehalten sind. Das Gericht unterstrich, dass der Staat durch die Delegation seiner Aufgaben die grundgesetzlichen Verpflichtungen nicht umgehen kann.
Aufgaben der Daseinsvorsorge
Die Daseinsvorsorge umfasst Aufgaben, die der Staat sicherstellen muss, um grundlegende Bedürfnisse der Bevölkerung zu erfüllen. Zu diesen Aufgaben gehören unter anderem die Gesundheitsversorgung, der öffentliche Nahverkehr und die Abfallwirtschaft. Oft delegieren Bund, Länder und Gemeinden diese Aufgaben an privatrechtlich organisierte Unternehmen wie GmbHs, sie behalten jedoch die Verantwortung für die Einhaltung grundlegender Prinzipien.
Folgen für privatrechtlich organisierte Institutionen
Das Urteil zeigt, dass privatrechtlich organisierte Institutionen, die hoheitliche Aufgaben ausführen, wie etwa die Verwaltung öffentlicher Güter oder die Durchführung staatlicher Leistungen, die Vorgaben des Artikel 33 Abs. 2 GG beachten müssen. Beispielsweise muss eine GmbH, die im Auftrag der Kommune den öffentlichen Nahverkehr organisiert, Stellen nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vergeben. Bevorzugungen oder Diskriminierungen sind unzulässig. Auch Vereine, die im Rahmen öffentlicher Aufträge agieren, wie etwa Rettungsdienste, unterliegen dem Verbot der willkürlichen Stellenbesetzung. Selbst Stiftungen, die hoheitliche Aufgaben wie die Verwaltung von Förderprogrammen übernehmen, müssen ein diskriminierungsfreies Bewerbungsverfahren gewährleisten.
Dieses Urteil hat somit weitreichende Folgen für die Organisation von Bewerbungsverfahren und der Personalauswahl in privatrechtlichen Institutionen, die hoheitliche Aufgaben ausüben.
Ausschreibungen und Auswahlverfahren müssen demnach transparent und objektiv gestaltet sein. Es reicht nicht aus, lediglich die formalen Kriterien zu erfüllen; eine konkrete Beurteilung der Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung der Bewerber ist für eine rechtssichere Stellenbesetzung notwendig. Zudem müssen Auswahlprozesse und – entscheidungen dokumentiert werden, um im Streitfall nachweisen zu können, dass diese objektiv und im Sinne des sogenannten Bewerberverfahrensanspruch durchgeführt wurden.
Fazit
Die Anwendung von Artikel 33 Absatz 2 GG auf privatrechtliche Institutionen, die hoheitliche Aufgaben wie die Daseinsvorsorge übernehmen, bringt klare rechtliche Verpflichtungen und entsprechende Folgen für die Unternehmen mit sich. Wird der Grundsatz der Bestenauslese infrage gestellt, kann eine Konkurrentenklage dazu führen, dass die Stellenbesetzung vorläufig gestoppt wird, bis eine abschließende gerichtliche Entscheidung vorliegt. Dies kann erhebliche Verzögerungen und organisatorische Herausforderungen mit sich bringen. Um dies zu vermeiden, sind transparente Auswahlverfahren, klare Dokumentationen und objektive Bewertungsmaßstäbe essenziell. Privatrechtliche Institutionen bleiben damit trotz ihrer Rechtsform an die Prinzipien der öffentlichen Verwaltung gebunden.