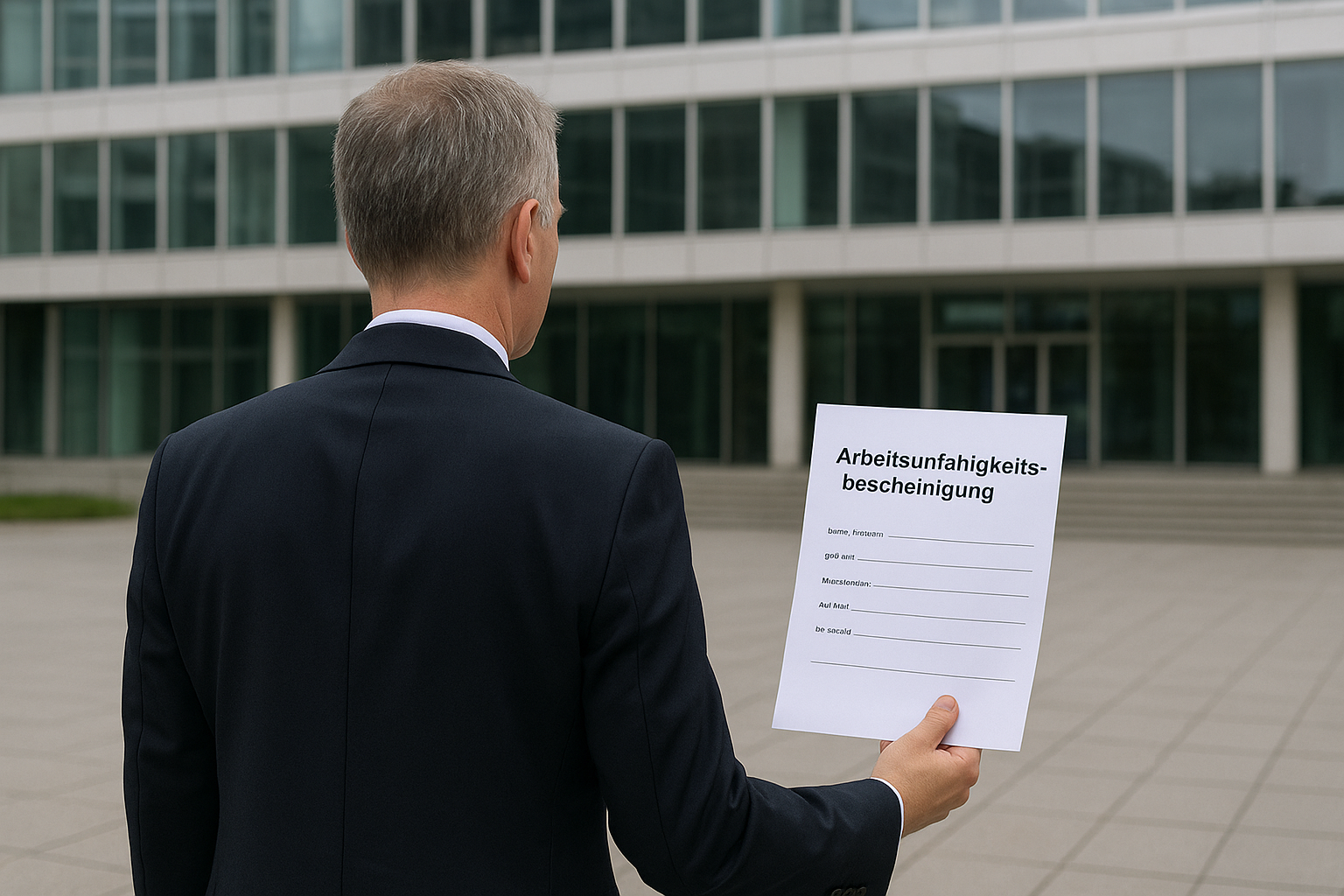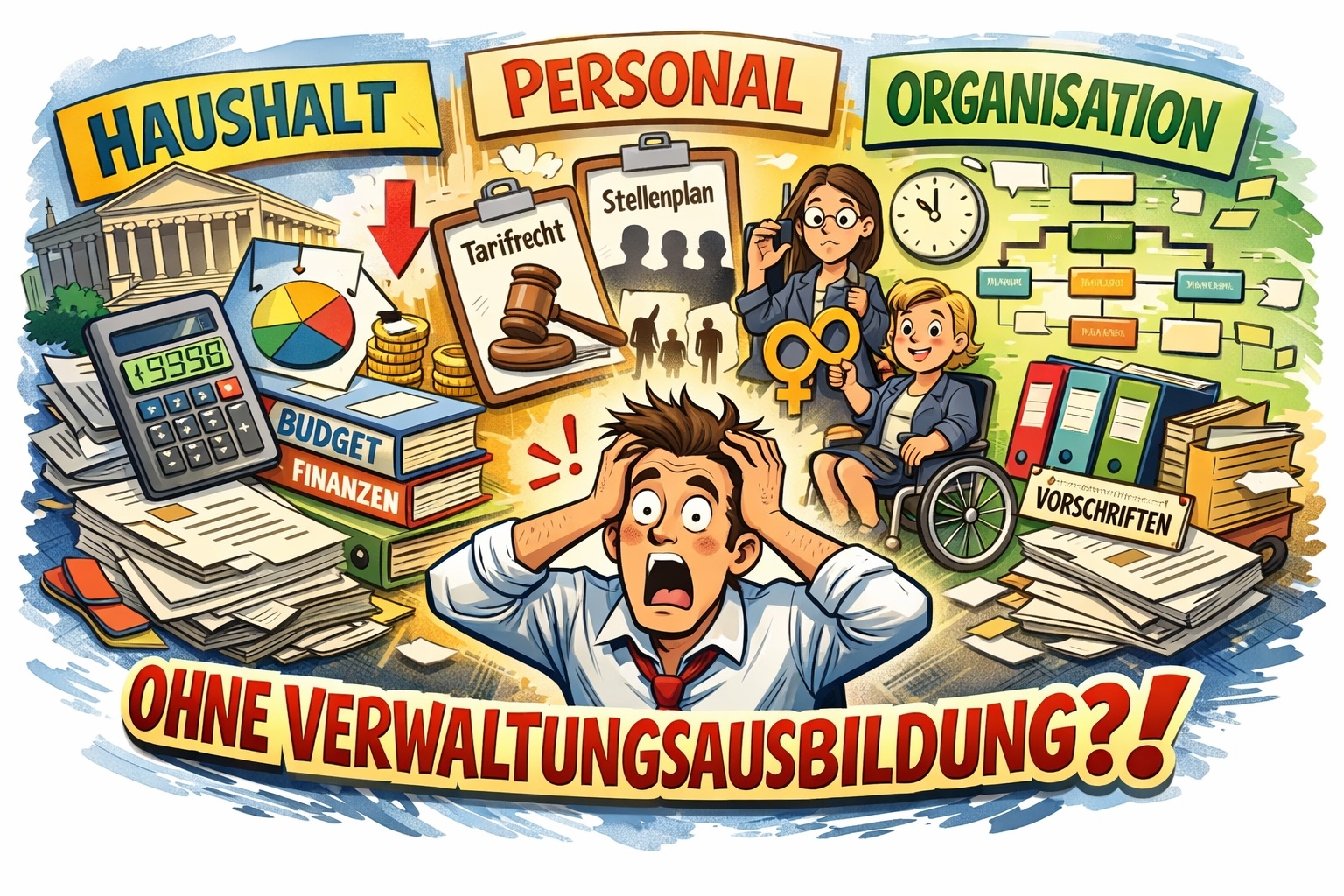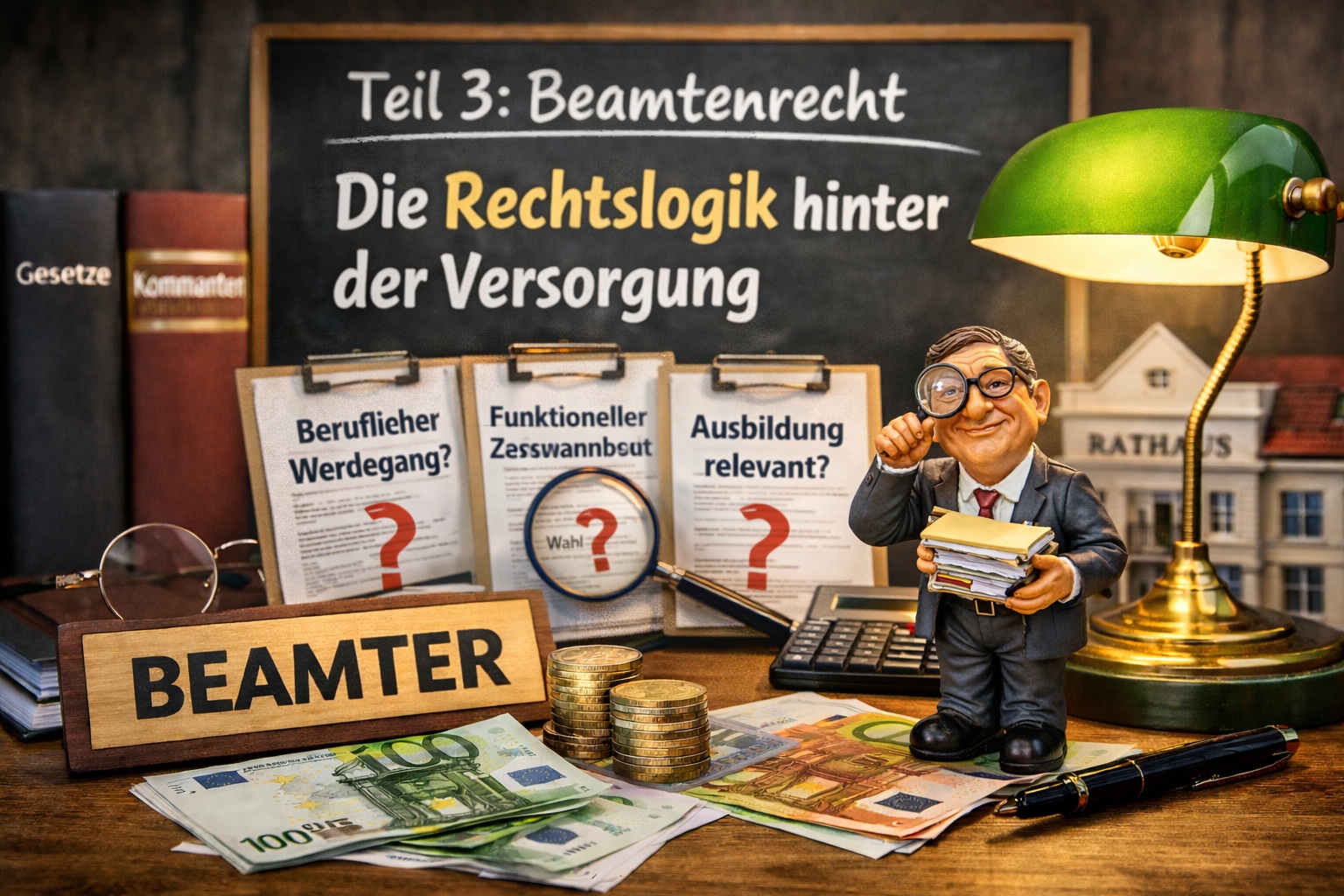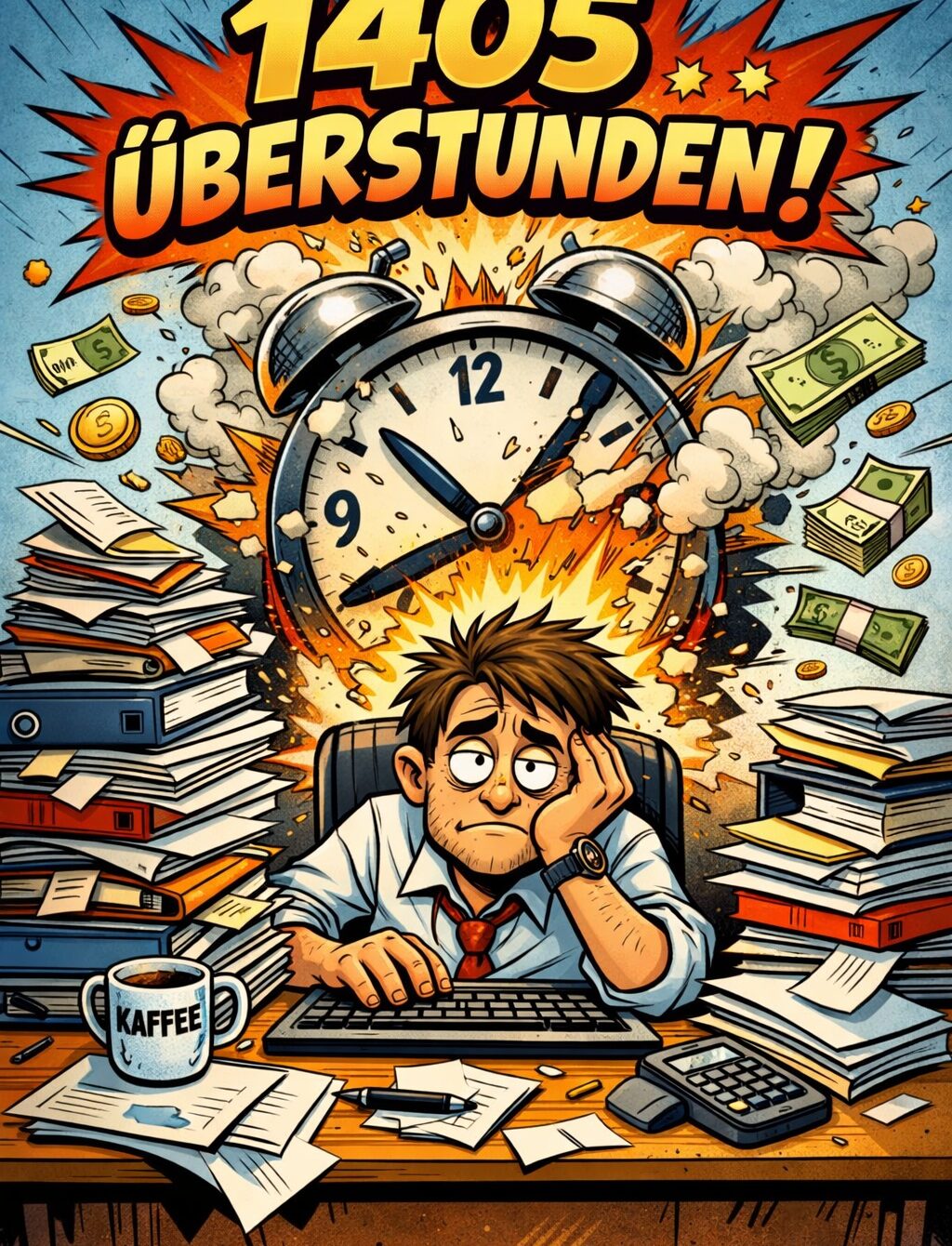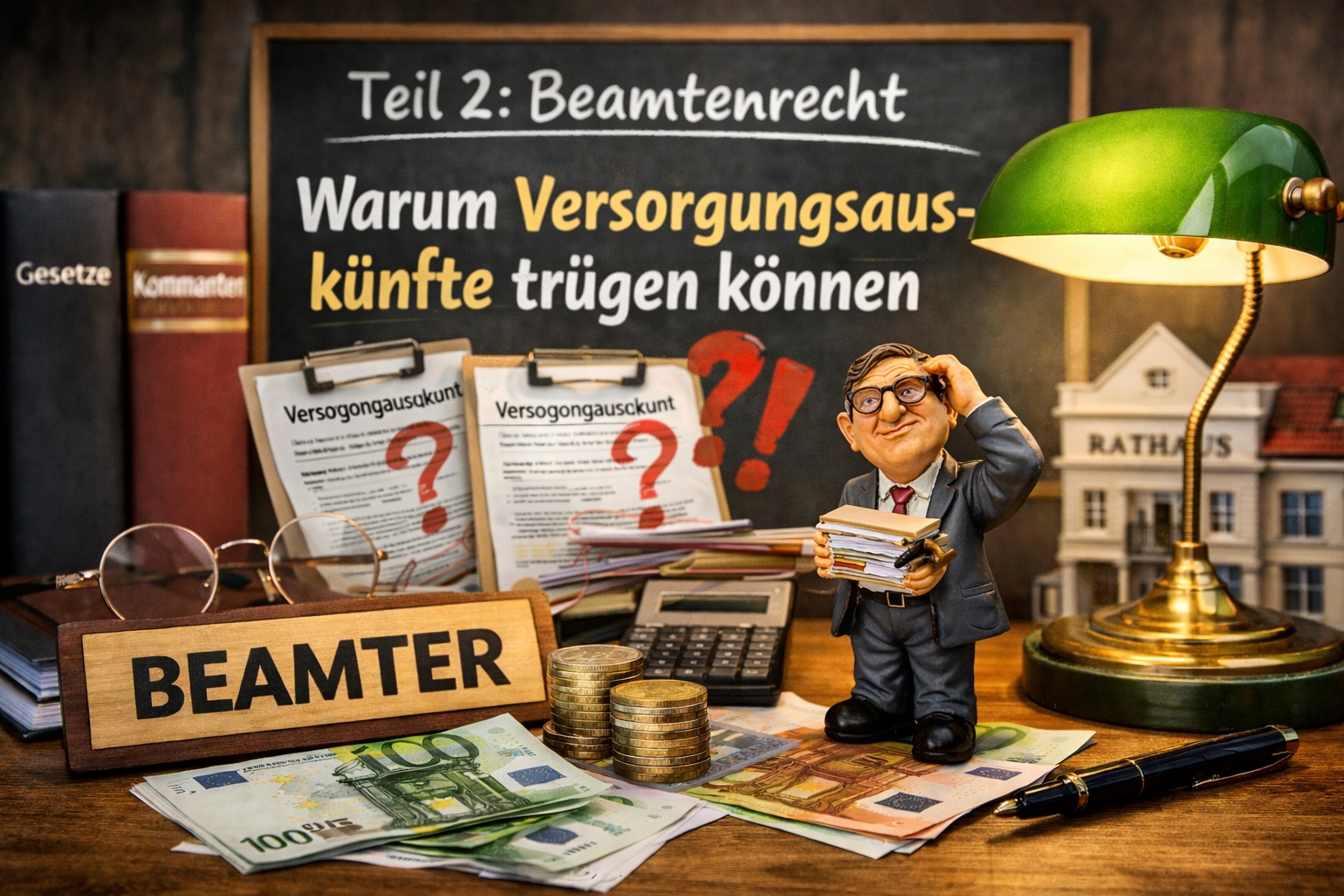Dieser Beitrag liefert einen Überblick, was Beschäftigte im öffentlichen Dienst bei der Krankmeldung beachten müssen und wie sich eine Arbeitsunfähigkeit auf die Stufenlaufzeit und die Jahressonderzahlung auswirkt.
Ist ein Beschäftigter wegen Krankheit an der Arbeitsleistung verhindert, muss er sich unverzüglich am ersten Tag der Erkrankung beim Arbeitgeber krankmelden, spätestens zu Zeitpunkt des geplanten Arbeitsbeginns. Dabei muss er auch die voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit mitteilen (§ 5 Abs. 1 Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG)).
Die Krankmeldung muss gegenüber dem Vorgesetzten erfolgen. Eine bestimmte Form ist im Gesetz jedoch nicht regelt. Sie kann folglich telefonisch, aber auch per WhatsApp, SMS oder E-Mail erfolgen, wenn dies in der Organisation üblich ist. Der Arbeitnehmer kann die Mitteilung entweder selbst vornehmen oder Dritte damit beauftragen – etwa Familienangehörige, Freunde oder Arbeitskollegen. Er muss dabei aber berücksichtigen, dass nicht die Mitteilung gegenüber dem Dritten zur Beurteilung der „Unverzüglichkeit“ maßgeblich ist, sondern der Zeitpunkt, in dem der Dienstherr von diesem Dritten tatsächlich informiert wird.
Krankmeldung im öffentlichen Dienst: Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
Für privat krankenversicherte Beschäftigte sowie für die Feststellung der Arbeitsunfähigkeit durch einen Arzt, der nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt (außerdem für geringfügig Beschäftigte in Privathaushalten und Zeiten von Rehabilitations- und Vorsorgemaßnahmen), gilt:
Wenn die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Tage dauert, muss der Beschäftigte dem Arbeitgeber an dem darauffolgenden Arbeitstag eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorlegen (§ 5 Abs. 1 S. 2 EFZG). Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als in der Bescheinigung angegeben, ist eine neue ärztliche Bescheinigung vorzulegen. Der Dienstherr kann die Bescheinigung auch früher verlangen (z. B. ab dem ersten Krankheitstag) – diese Entscheidung liegt im Ermessen des Arbeitgebers und muss nicht begründet werden. Betrifft dies mehrere Beschäftigte (z. B. durch entsprechende Vereinbarungen im Arbeitsvertrag), bedarf diese Anordnung der vorherigen Zustimmung des Betriebs- bzw. Personalrats.
Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
Zum 01.01.2023 entfiel die Vorlagepflicht einer AU-Bescheinigung für gesetzlich versicherte Beschäftigte an den Dienstherrn. Der Beschäftigte muss nur noch die Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer feststellen lassen. Dabei handelt es sich um eine Obliegenheit – nicht um eine Pflicht des Beschäftigten.
Die Kommunikation zwischen Arzt und Krankenkasse findet schon seit dem 01.01.2021 elektronisch statt. Die Meldung der Arbeitsunfähigkeit an den Arbeitgeber erfolgt seit dem 01.01.2023 auf diesem Weg.
Durch das eAU-Verfahren entfällt jedoch nur die Nachweispflicht des Beschäftigten. Er bleibt verpflichtet, sich bei seinem Dienstherrn unverzüglich arbeitsunfähig zu melden (Anzeigepflicht) und die voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit mitzuteilen. Dies gilt auch bei der Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit über einen erstmals oder folgend festgestellten Zeitraum hinaus.
Entgeltfortzahlung nach TVöD und TV-L
Wenn der Beschäftigte ohne sein Verschulden infolge einer Krankheit arbeitsunfähig ist, leistet der Dienstherr Entgeltfortzahlung (§ 22 Abs. 1 TVöD TV-L). Der Anspruch besteht auch in den ersten vier Wochen des Arbeitsverhältnisses. Im Unterschied zur gesetzlichen Regelung kennen die Tarifverträge des öffentlichen Dienstes keine Wartezeit.
Begriff der Arbeitsunfähigkeit
Eine Arbeitsunfähigkeit liegt vor, wenn der Beschäftigte die ihm vertragsgemäß obliegende Arbeit infolge einer Krankheit nicht erfüllen kann oder ihm diese nicht zugemutet werden kann. Unter „Krankheit“ fällt jeder regelwidrige körperliche oder geistige Zustand. Von der Entgeltfortzahlung wegen Krankheit werden auch medizinische Vorsorge- oder Reha-Maßnahmen (§ 22 Abs. 1 S. 3 TVöD bzw. TV-L) oder ein Umfall umfasst.
Keine Erkrankung im Sinne der Entgeltfortzahlung sind eine normal verlaufende Schwangerschaft, eine künstliche Befruchtung oder medizinisch nicht notwendige Schönheitsoperationen.
Auswirkungen einer Arbeitsunfähigkeit auf die Jahressonderzahlung?
Krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit, solange ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung (in den ersten sechs Wochen der Krankheit) oder Krankengeldzuschuss besteht, nicht zu einer Kürzung der Jahressonderzahlung.
Besonderheiten ergeben sich allerdings bei der Berechnung der Jahressonderzahlung, wenn über die 6-Wochen-Entgeltfortzahlung hinausgehende Krankheitszeiten in die Monate Juli, August oder September – den Bemessungszeitraum für die Jahressonderzahlung – fallen. Wird in diesem Entgelt oder Entgeltfortzahlung nach § 21 TVöD bzw. TV-L nicht oder nur an weniger als 30 Kalendertagen gezahlt, berechnet sich die Jahressonderzahlung nach dem letzten vollen Kalendermonat vor Beginn der Krankheit.
Hat eine Arbeitsunfähigkeit Auswirkungen auf die Stufenlaufzeit?
Solange Anspruch auf Entgeltfortzahlung (in den ersten sechs Wochen der Krankheit) oder Krankengeldzuschuss (längstens bis zum Ende der 13. Bzw. 39. Kalenderwoche), kommt es nicht zu einer Unterbrechung der Stufenlaufzeit für den Aufstieg in die nächsthöhere Entgeltstufe (§ 17 Abs. 3b TVöD bzw. TV-L).