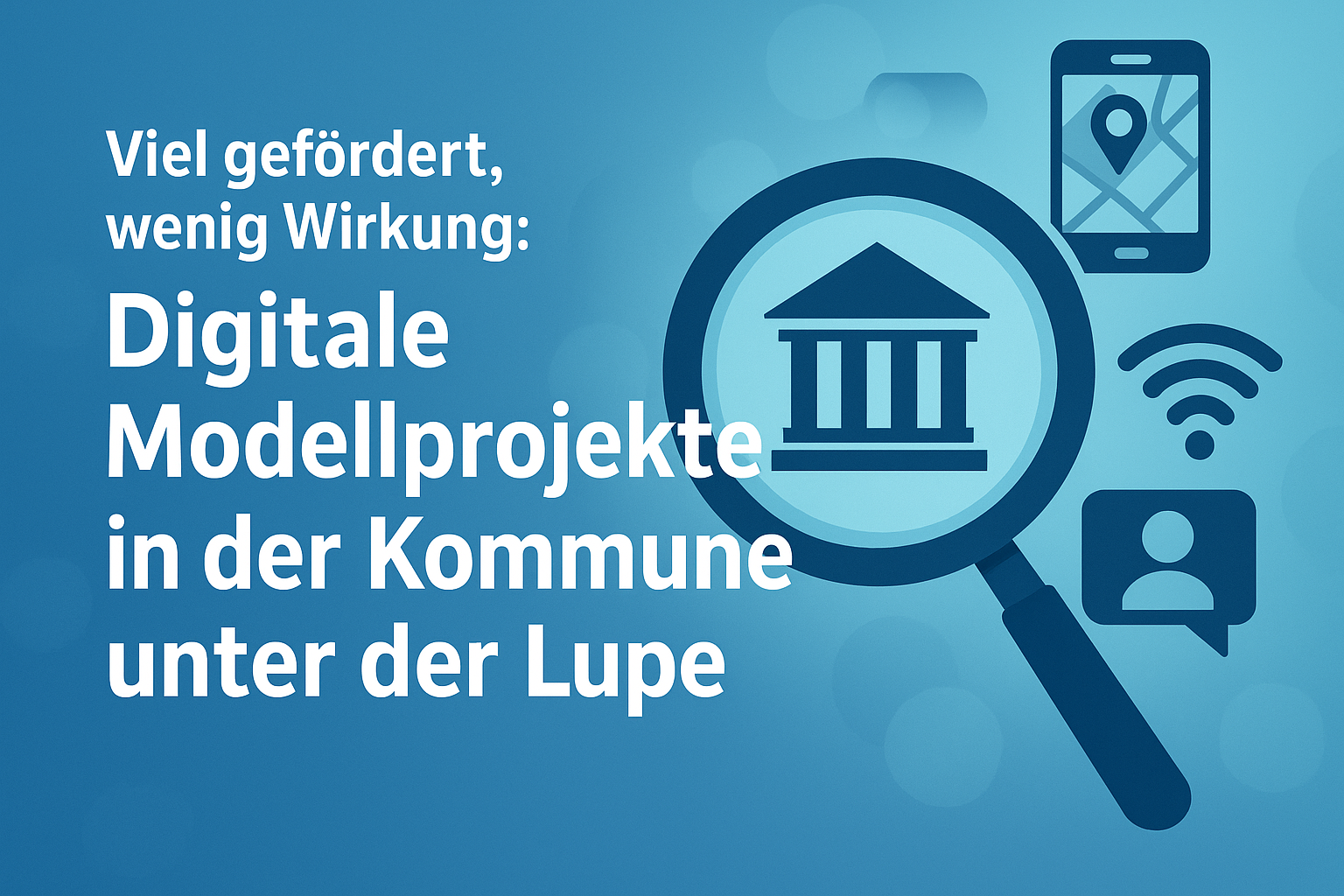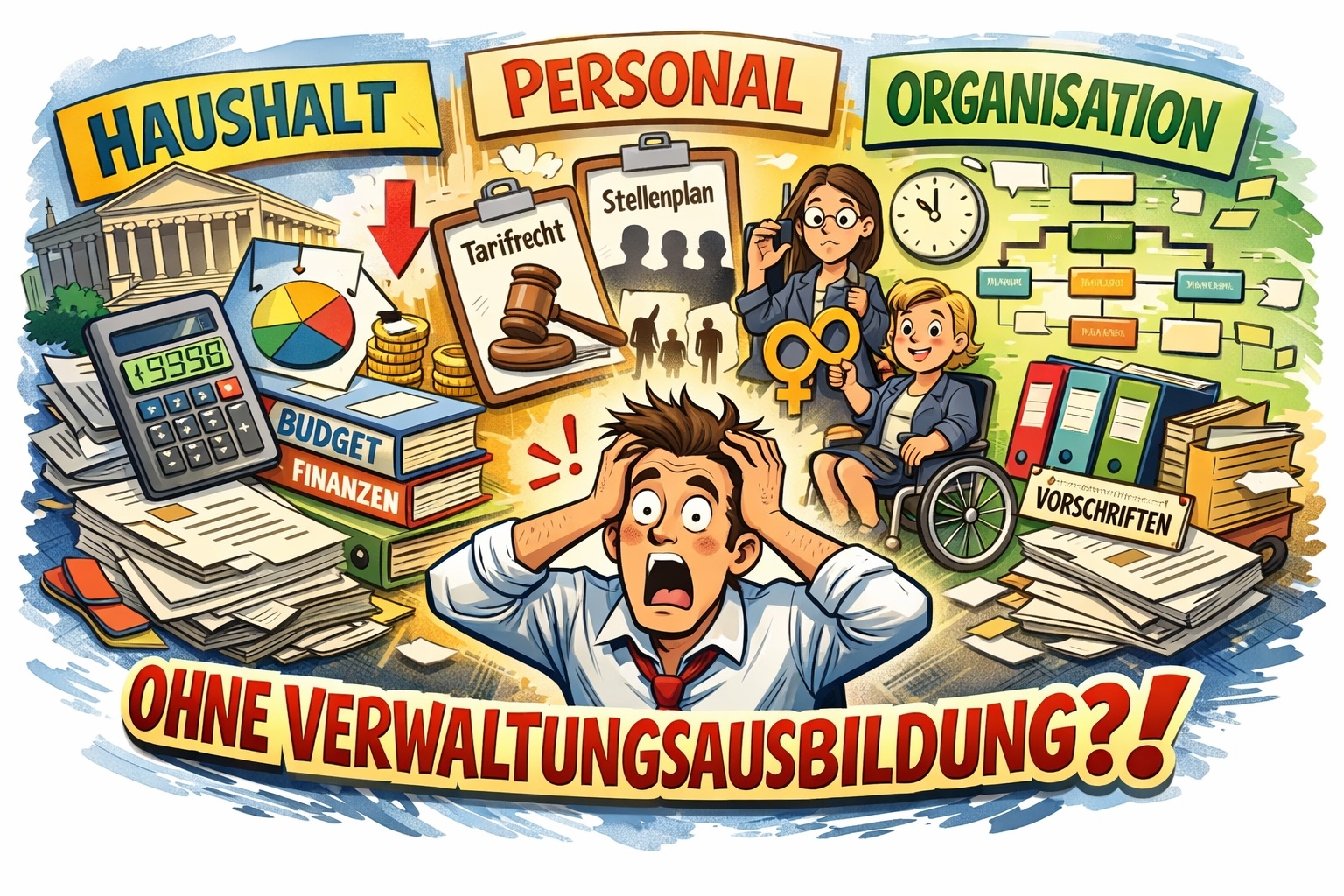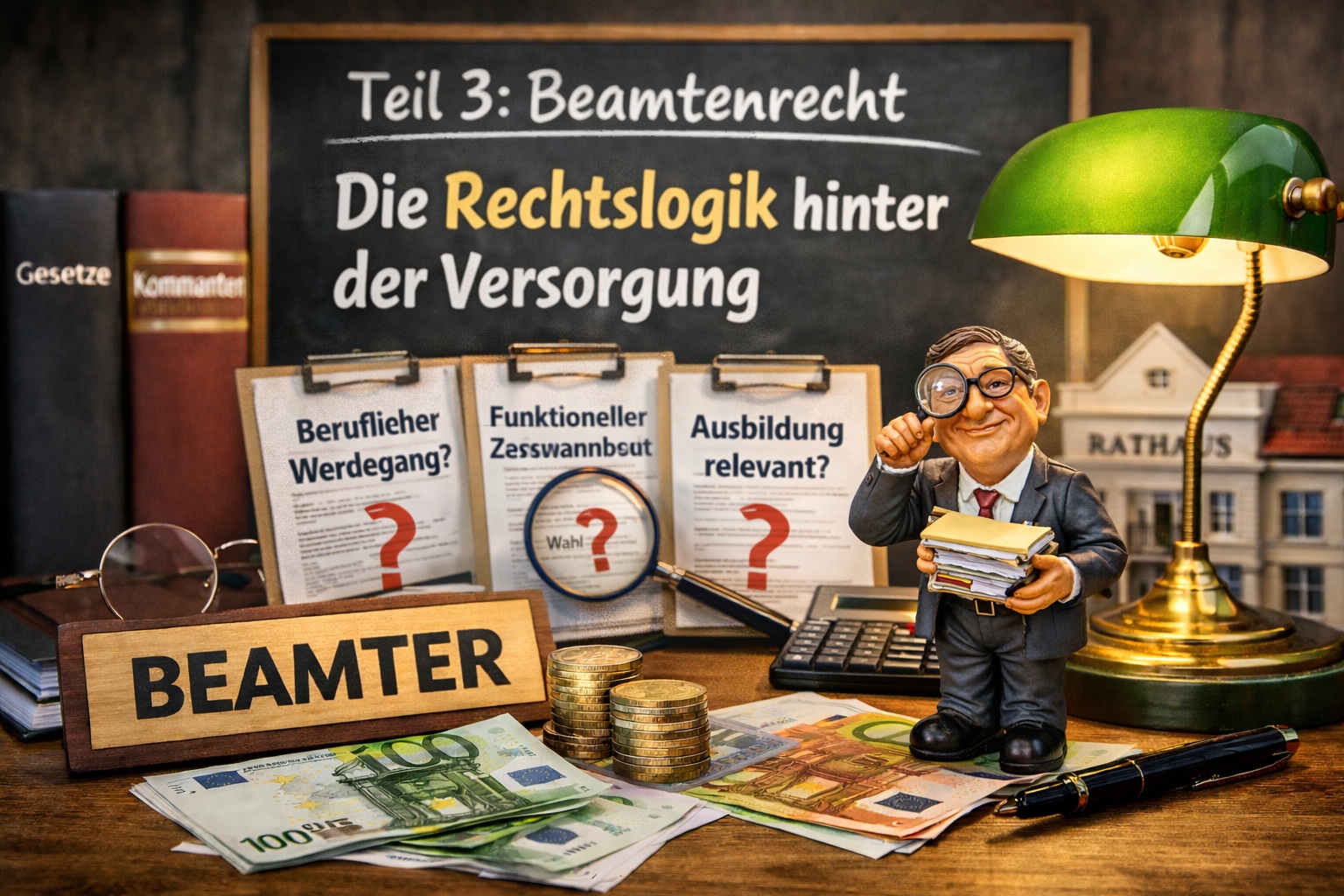Einleitung
Bund und Länder investieren seit Jahren Millionen in digitale Modellprojekte – von Navigations-Apps über Dorfportale bis hin zu Verwaltungssoftware. Eine aktuelle Untersuchung von Großklaus (2025) der Agora Digitale Transformation zeigt jedoch: Die erhoffte Wirkung bleibt oft aus. Viele Innovationen schaffen es nicht über ihre Ursprungskommunen hinaus, Transfer und Nachnutzung finden kaum statt.
1. Warum verpuffen Fördermittel?
Das Hauptproblem liegt laut Analyse in der Struktur der Förderprogramme. Sie schaffen zwar neue digitale Lösungen, doch diese bleiben meist auf die geförderten Standorte beschränkt.
Anstelle flächendeckender Netzwerke entstehen vielerorts isolierte Projekte. Fehlanreize, zu starke Fokussierung auf Innovation um jeden Preis und fehlende Strategien für den Transfer verhindern eine nachhaltige Wirkung.
2. Redundanzen statt Synergien
In der vergangenen Legislaturperiode starteten acht Bundesministerien insgesamt 29 Förderprogramme – vielfach mit ähnlichen Schwerpunkten. Häufig wurden vergleichbare technische Lösungen mehrfach gefördert, etwa Mobilitäts-Apps, Verwaltungstools oder Anwendungen im Bereich Tourismus und e-Health.
Gerade in Zukunftsfeldern wie Künstlicher Intelligenz erwarten Expertinnen und Experten noch stärkere Überschneidungen.
3. Mehr Handlungsspielraum als genutzt
Oft wird angenommen, dass Nachnutzung allein Sache der Länder sei. Ein juristisches Gutachten zeigt jedoch: Der Bund hätte ausreichend Spielraum, um stärker auf Transfer und Nachnutzung zu setzen – auch im Sinne des Wirtschaftlichkeitsgebots.
4. Vorschläge für ein wirksameres Fördersystem
Die Studie empfiehlt mehrere Ansätze für eine grundlegende Reform:
- Regionale Kooperation statt Einzelprojekte: Fördergelder sollten gezielt gemeinsame Entwicklungen unterstützen.
- Nachnutzung verpflichtend verankern: Förderbedingungen müssen Transferfähigkeit voraussetzen.
- Erfolgreiche Projekte in den Regelbetrieb überführen: Besonders bewährte Lösungen sollen langfristig weitergeführt werden.
- Programme bündeln: Ressortübergreifende Abstimmung, um Doppelstrukturen zu vermeiden.
- Bund-Länder-Kooperationen: Gemeinsame Programme für effizientere Mittelverwendung.
5. Verpasste Chancen am Beispiel „Einer-für-Alle“-Lösungen
Das Onlinezugangsgesetz sieht vor, dass digitale Verwaltungsleistungen zentral entwickelt und anschließend flächendeckend bereitgestellt werden. Der Bundesrechnungshof kritisierte jedoch, dass 95 % dieser Lösungen bislang nur in einzelnen Ländern oder Kommunen genutzt werden.
Fazit
Die Untersuchung macht deutlich: Es fehlt nicht an guten Ideen, sondern an Strukturen für ihre Verbreitung. Fördermittel entfalten ihr Potenzial erst, wenn Projekte von Beginn an auf Nachnutzung und Kooperation ausgerichtet werden.
Die Ursprungsstudie mahnt daher an, Förderpolitik verbindlicher, vernetzter und strategischer zu gestalten – damit digitale Erfolge nicht im Modellstatus verharren, sondern den Alltag in vielen Kommunen bereichern.
#kommune #foedermittel #foedermittelmanagement
Sollten Sie trotz Kritik an den Fördertöpfen Beratung und Unterstützung bei der Fördermittelakquise oder -beantragung wünschen, stehen wir Ihnen gern mit Rat und Tag zur Verfügung:
Literatur:
Großklaus, M. (2025). Nachnutzung digitaler Lösungen statt Modellprojekte: Förderprogramme für Kommunen auf die Fläche ausrichten (Policy Paper). Agora Digitale Transformation. https://doi.org/10.5281/zenodo.15827700