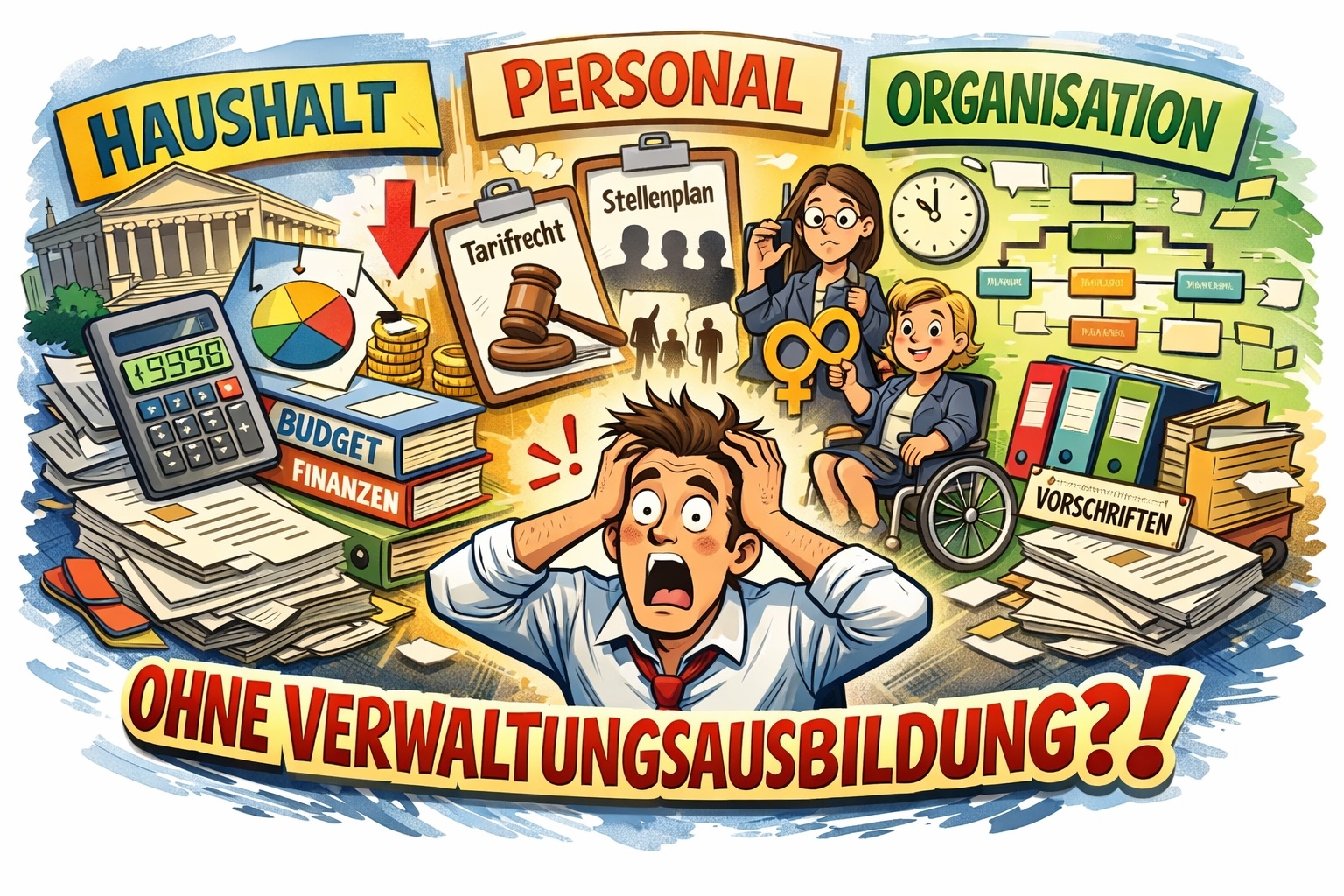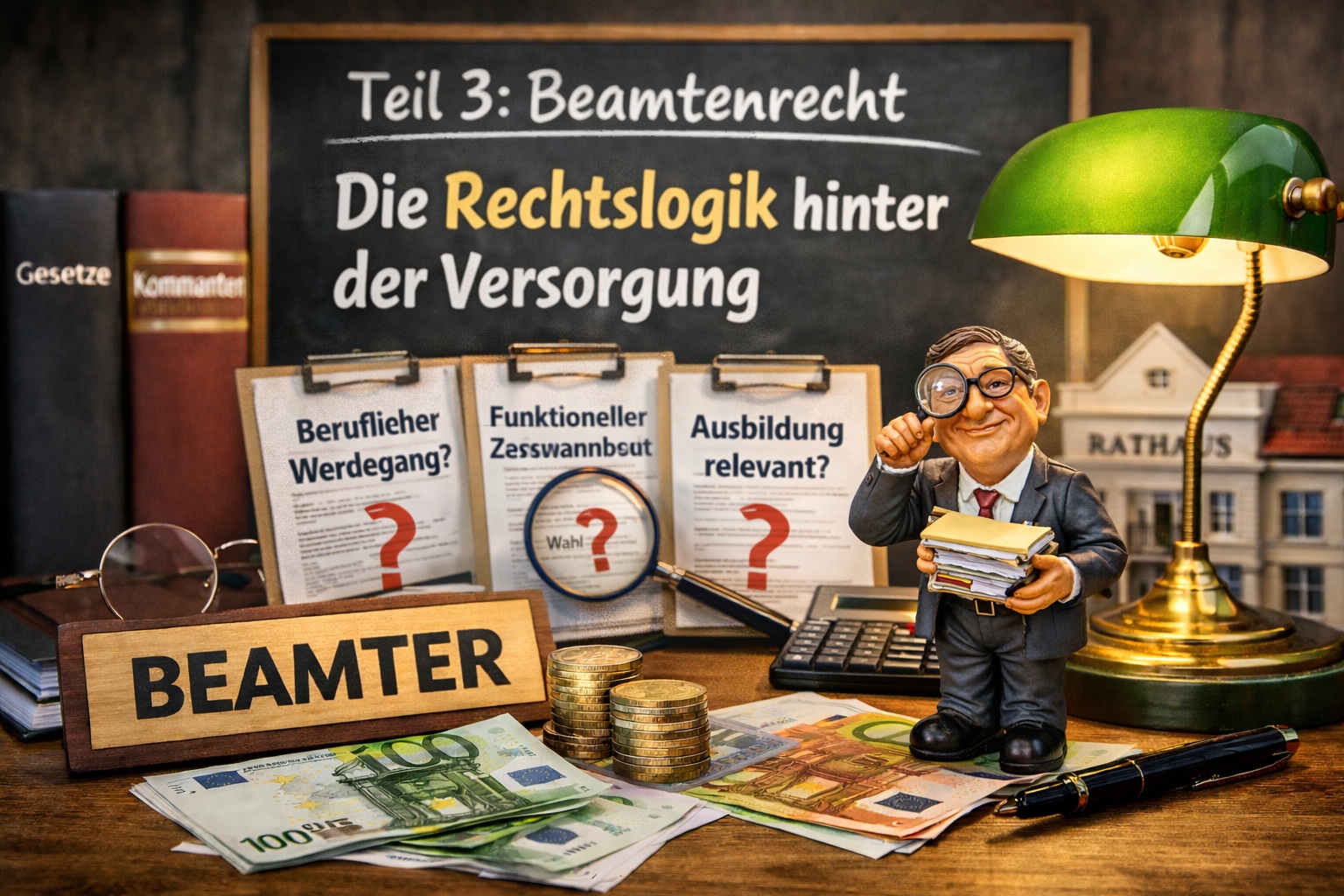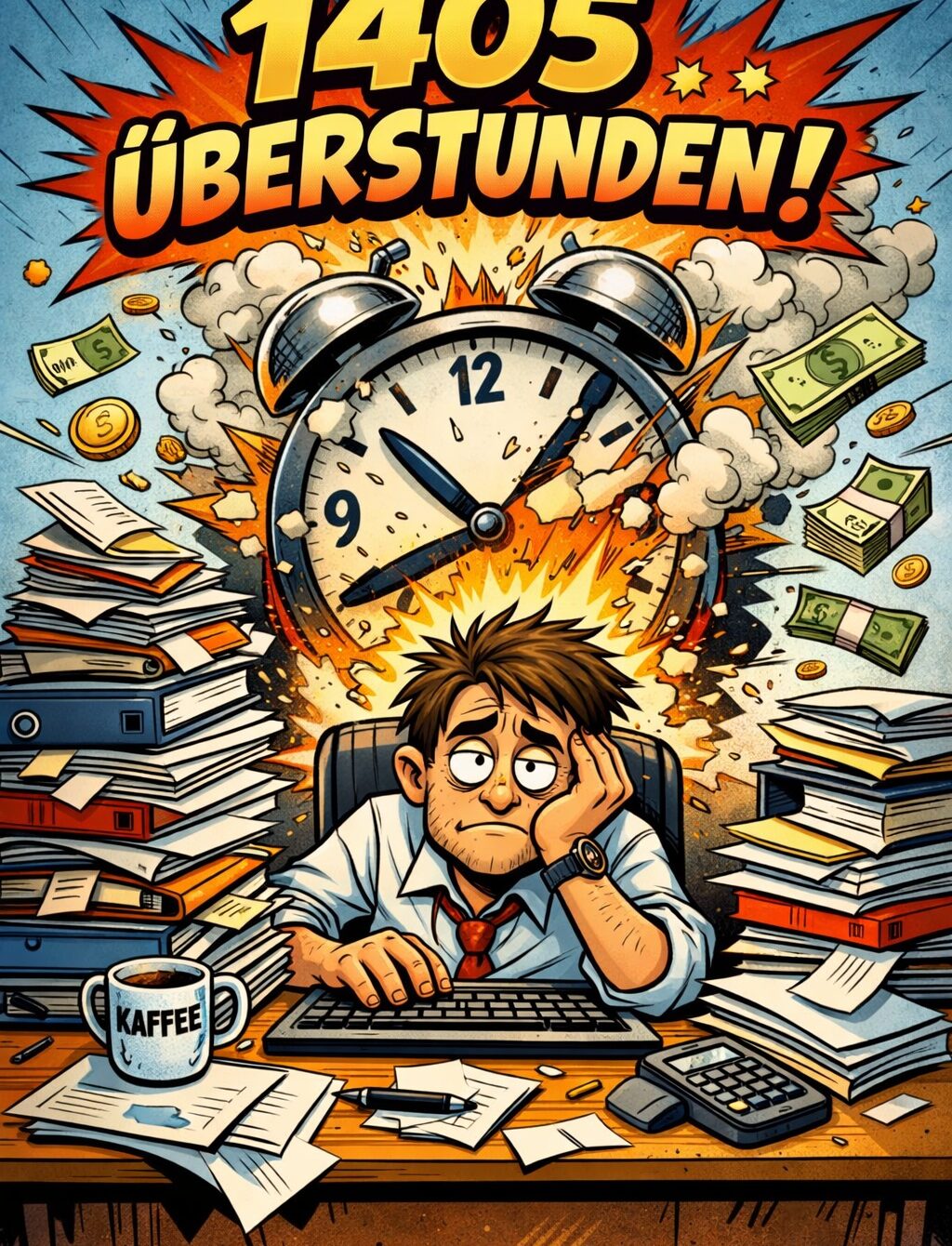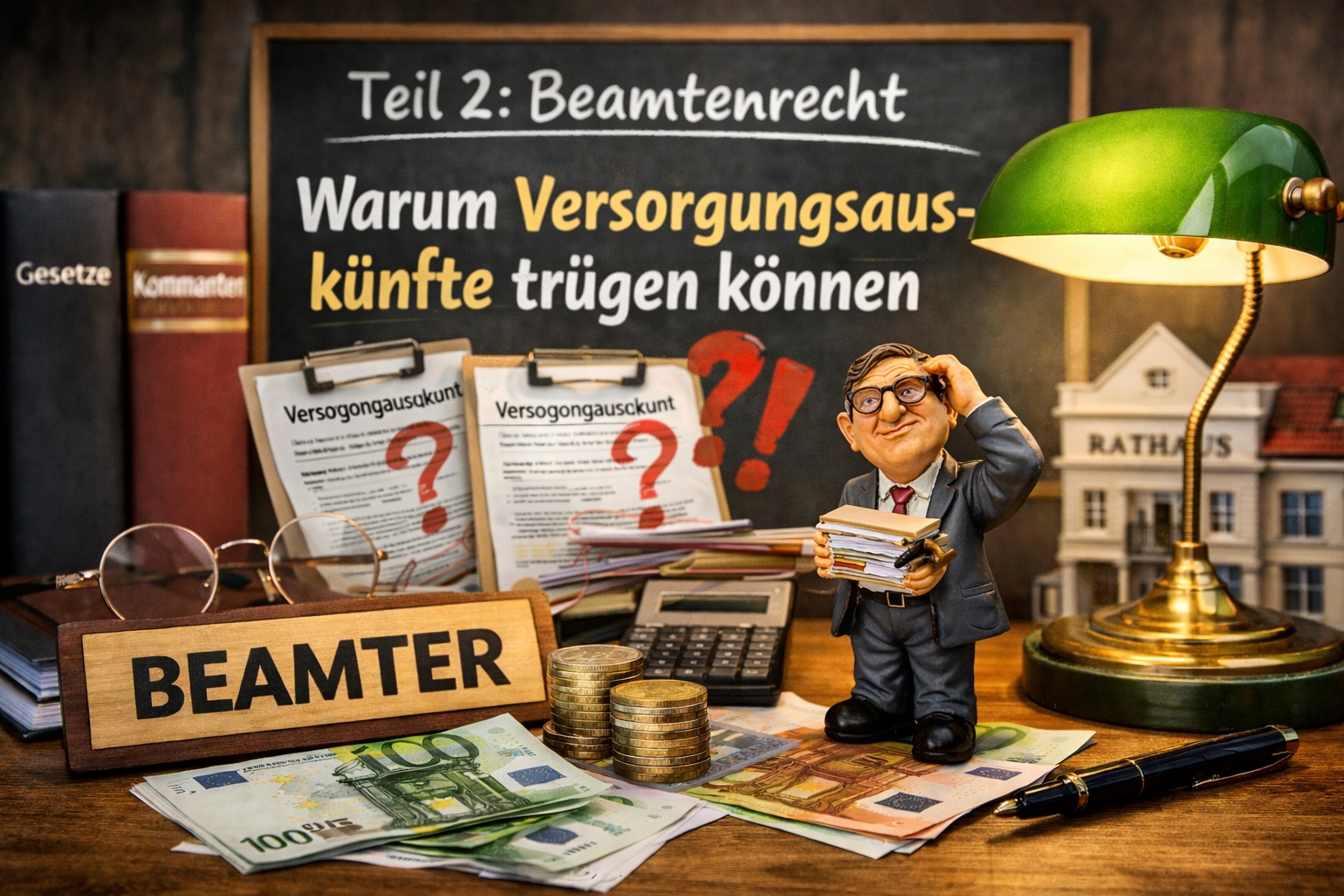In unserem letzten Beitrag zu verschiedenen irrtümlichen Ansichten – oder Mythen – der Personalarbeit wurden die Themenfelder Erfahrung, Menschenkenntnis und Körpersprache beleuchtet.
Der zweite Artikel dieser Serie behandelt die Aspekte Generationen, Personalentwicklung sowie Personalauswahl.
Mythos 4: Die Generationen verändern sich dramatisch
Hierbei handelt es sich um eine verhältnismäßig junge Annahme. Im Grunde genommen besagt diese, dass Menschen von Generation zu Generation sehr unterschiedlich sozialisiert werden und daher weitestgehend unterschiedliche Sichtweisen auf das Leben haben. Dies soll weitreichende Konsequenzen für die gesamte Personalarbeit – vom Personalmarketing bis zur Führung – haben.
Problematisch ist bei dieser Theorie jedoch, dass unklar ist, ab welchem Geburtsjahr genau eine Generation anfängt und die andere aufhört. Hierüber besteht keine absolute Einigkeit. In der Folge werden in verschiedenen Definitionen Millionen von Menschen zwischen den verschiedenen Generationen hin- und hergeschoben. Studien, die verschiedene Generationen im Hinblick auf grundlegende Arbeitswerde miteinander vergleichen, zeigen nur sehr geringe Unterschiede, die in der öffentlichen Diskussion oftmals überschätzt werden. Des Öfteren stehen die Ergebnisse sogar im Widerspruch zu weit verbreiteten Überzeugungen. So sind jüngere Menschen im Mittelwert zum Beispiel ein klein wenig leistungsorientierter als ältere und interessieren sich auch mehr für Geld.
Ein weiteres, vielleicht sogar stärkeres Argument gegen das Denken in Generationen ergibt sich aus der Vielzahl der Menschen, die in einer Generation zu finden sin. Generation Y umfasst bspw. fast 15 Millionen, während in Generation Z lediglich etwa neun Millionen Menschen zu finden sind. Eine derart große Stichprobe besitzt sehr wenig Aussagekraft. So wird es in jeder Generation zehntausende Menschen geben, für die der Beruf der zentrale Lebensinhalt ist, und zehntausende, die am liebsten gar nicht arbeiten möchten. Es gilt daher, (junge) Menschen als Individuum wahrzunehmen – und nicht als Vertreter einer Generation.
Mythos 5: Personalentwicklung ist wichtiger als Personalauswahl
Viele Organisationen verwenden nicht sehr viel Mühe und Know-how für ihre Personalauswahlverfahren. Dies äußert sich etwa in Form von unstrukturierten Einstellungsinterviews. Demgegenüber setzen Organisationen vielerorts eine große Anzahl an Personalentwicklungsmaßnahmen – Trainings, Coaching, Mentoren – ein. Aus Sicht der Forschung ist der unmittelbare Effekt dieser Methoden oft überschaubar: Die nachweisbaren Effektstärken von Führungskräftetrainings, Coaching und Mentoring liegen in der Regel bei unter zehn Prozent.
Angenommen, man würde Intelligenztests in der Personalauswahl einsetzen, wäre alleine dadurch mit einer Verbesserung der Auswahlverfahren mit einem durchschnittlichen Effekt von etwa 25 Prozent zu rechnen, meint Prof. Dr. Uwe Peter Kanning von der Hochschule Osnabrück. Bei hohen Managementpositionen liege der Wert jenseits der 40 Prozent, so Kanning. Seiner Ansicht nach komme es darauf an, die vorhandenen Möglichkeiten realistisch einzuschätzen. Im Bereich der Fachkompetenz sind Weiterbildungsmaßnahmen sicherlich sinnvoll. Wenn es jedoch um Soft Skills geht, sind die Spielräume der Veränderbarkeit deutlich kleiner, als oftmals angenommen.
Mythos 6: Personalauswahl wird immer unwichtiger
In Zeiten des Fachkräftemangels neigen viele Organisationen dazu, die Bedeutung guter Personalauswahl zu unterschätzen. Laut Uwe Kanning könne man den Eindruck gewinnen, als seien Verantwortliche froh darüber, wenn sich überhaupt jemand auf offene Stellen bewerbe, weshalb es sich nicht mehr lohne, in gute Personalauswahl zu investieren. Solange eine Organisation jedoch noch mehr Bewerbungen als offene Stellen habe, sei genau das Gegenteil der Fall, so Kanning. Demnach sei nicht die Anzahl der Bewerbungen entscheidend, sondern die Qualität des Bewerberpools.
Zur Verdeutlichung führt der Professor für Wirtschaftspsychologie ein Rechenbeispiel an:
Auf eine vakante Stelle gehen zehn Bewerbungen ein, von denen vier Personen für die Stelle geeignet sind. Die Aufgabe der Personalauswahl besteht nun darin, eine dieser vier Personen zu identifizieren. Die Wahrscheinlichkeit, durch ein sehr schlechtes Auswahlverfahren einen Treffer zu landen, liegt bei 40 Prozent. Doch qualitativ hochwertige Personalauswahlmethoden (hochstrukturiertes Interview, Intelligenztest, Arbeitsproben etc.) lassen diesen Prozentwert in die Höhe steigen.
In Zeiten des Fachkräftemangels ist nicht nur die Anzahl der eingehenden Bewerbungen gesunken, sondern auch der Anteil derjenigen, die für eine Stelle geeignet sind. Demzufolge gehen heute vielleicht nur noch fünf Bewerbungen für eine vakante Stelle ein, von denen eine Person tatsächlich geeignet ist. Die Zufallswahrscheinlichkeit für einen Treffer liegt jetzt nur noch bei 20 Prozent. Das Auswahlverfahren muss mithin die Schwäche des Arbeitsmarktes ausgleichen. Je geringer die Qualität des Bewerberpools ausfällt, desto valider muss das Auswahlverfahren sein. Organisationen müssen in Zeiten des Fachkräftemangels mehr in die Qualität ihrer Personalauswahl investieren, wenn sie eine vergleichbare Qualität bei den Neueinstellungen erreichen wollen.