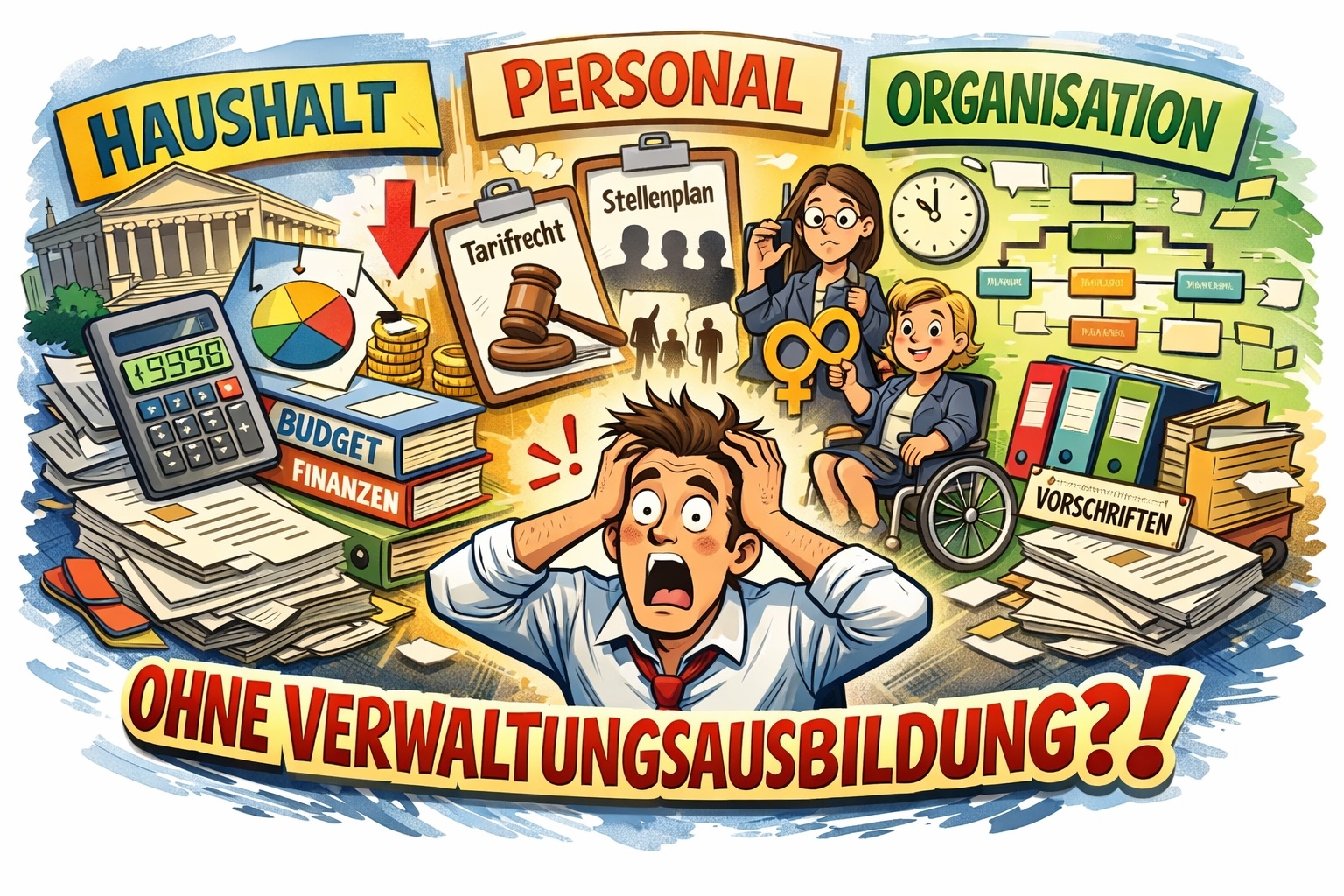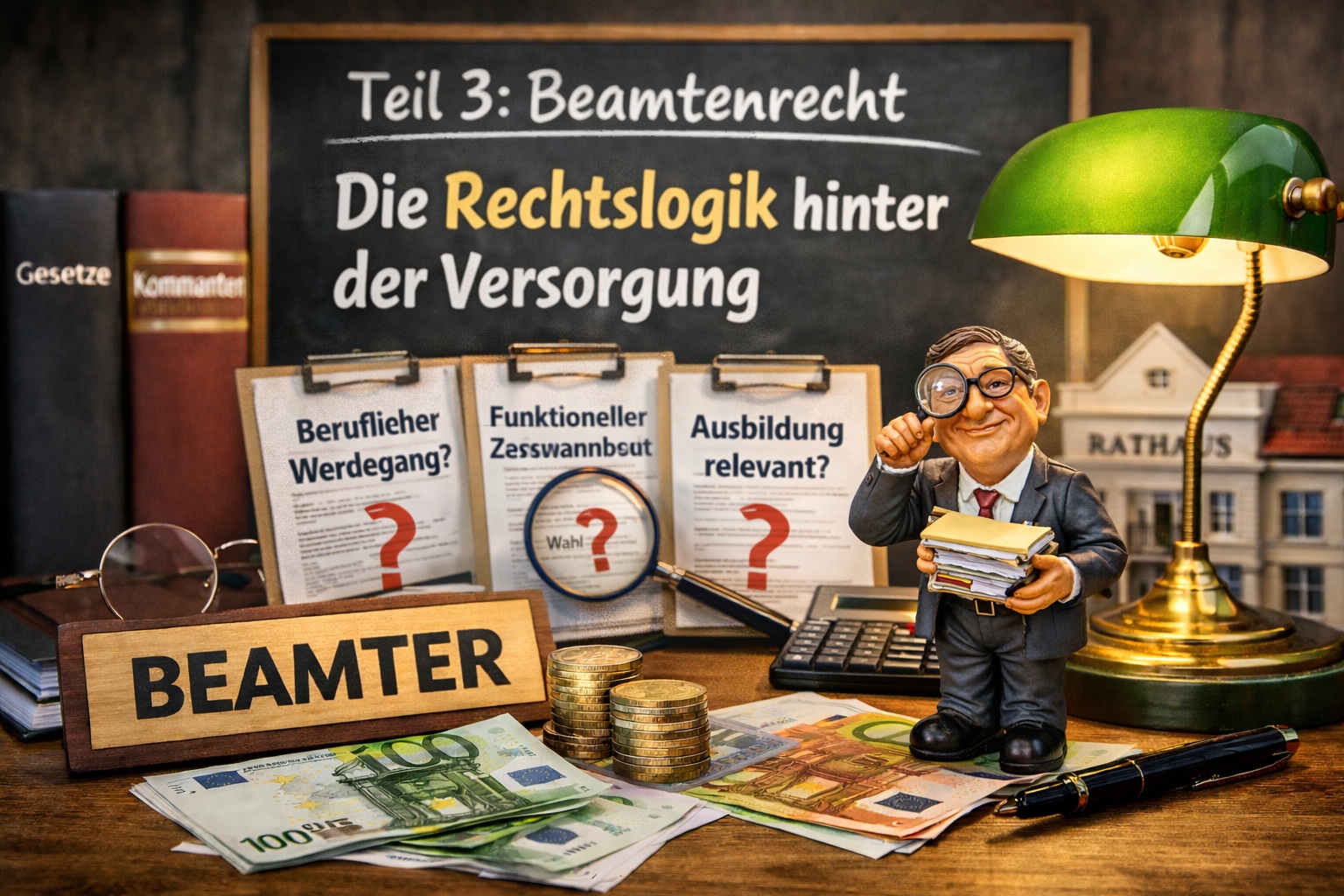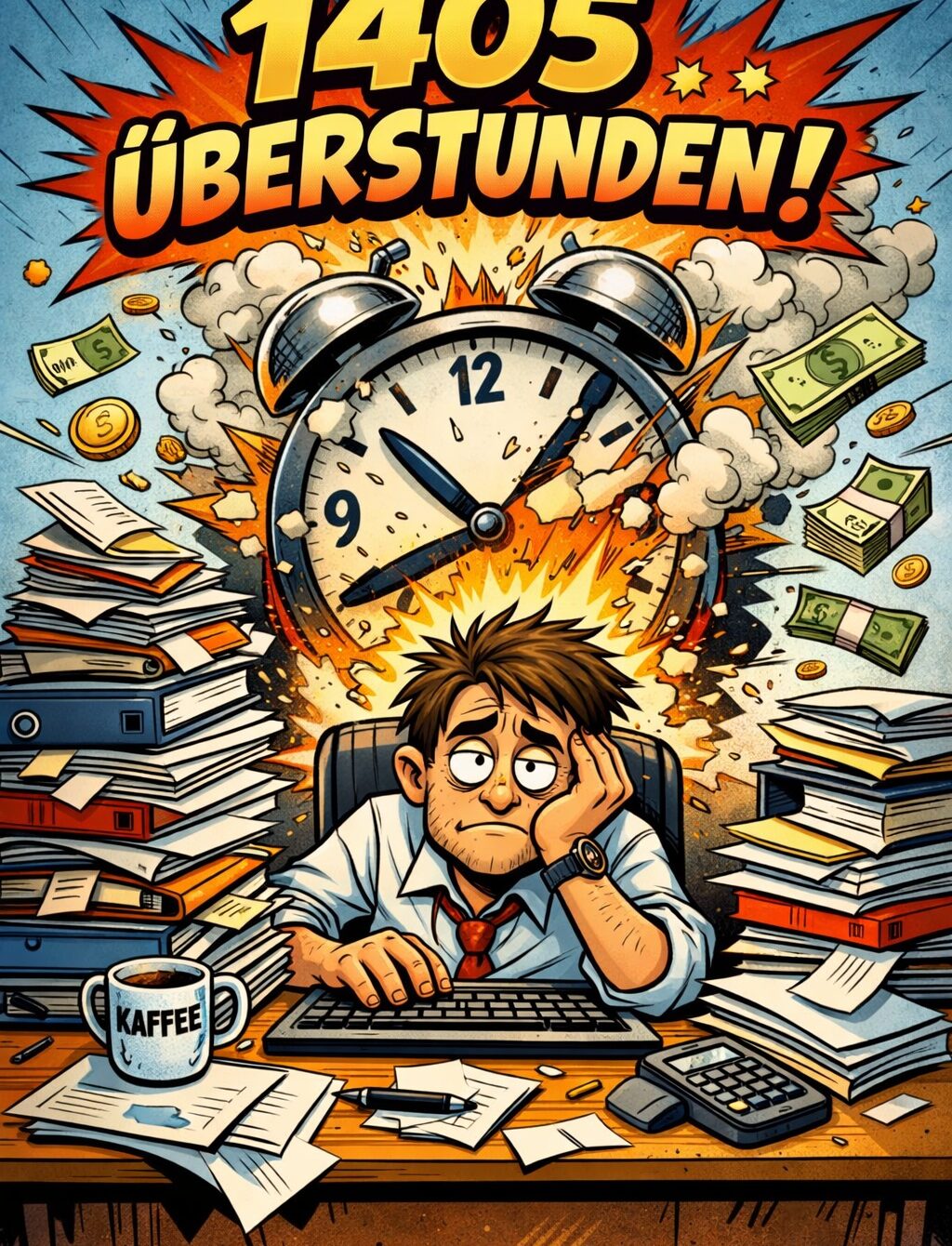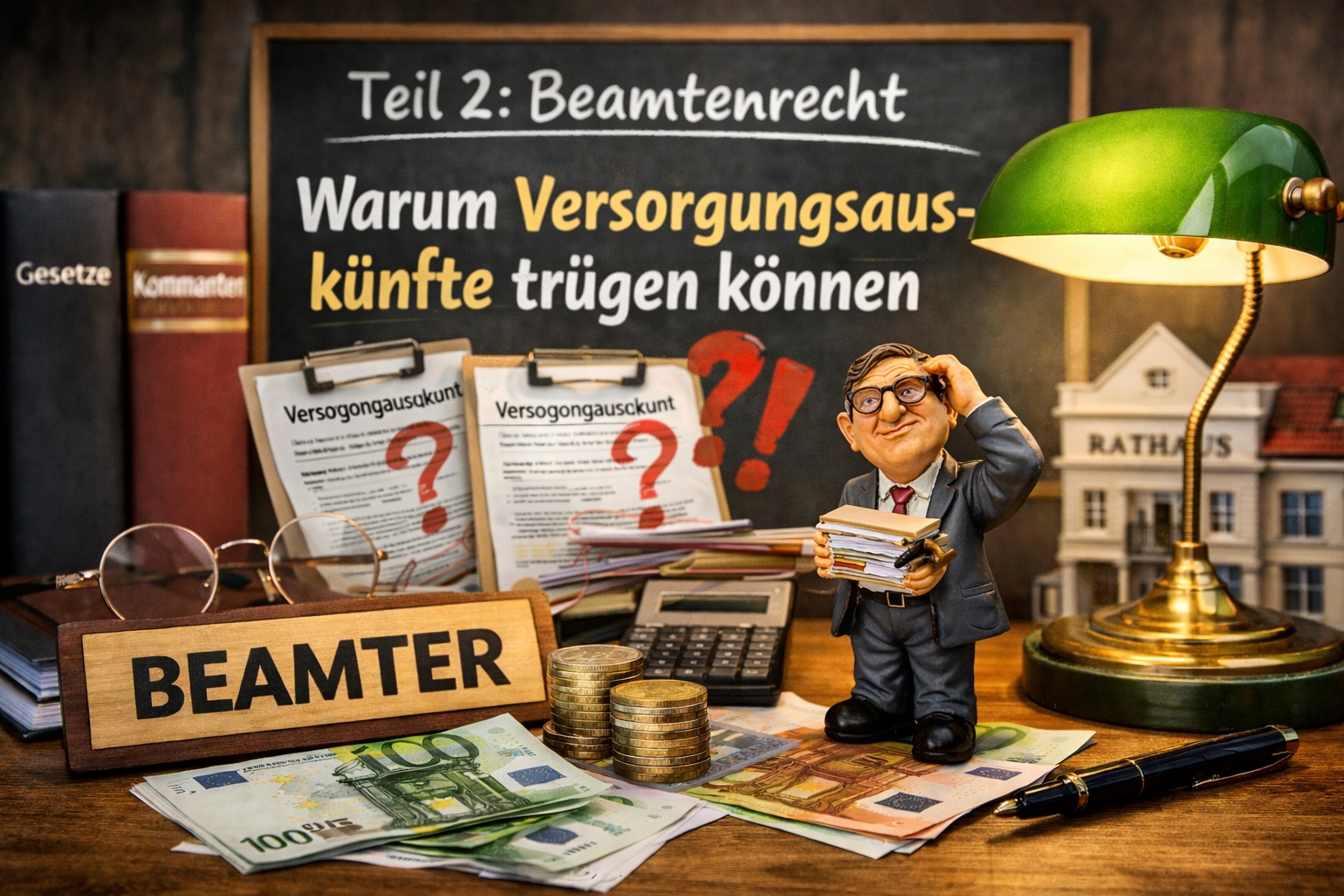Wenn Beschäftigte ohne ihr Verschulden infolge einer Krankheit arbeitsunfähig sind, leistet der Arbeitgeber Entgeltfortzahlung. Ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung besteht allerdings nicht, wenn die Beschäftigten die Arbeitsunfähigkeit verschuldet haben (§ 3 Entgeltfortzahlungsgesetz).
Was passiert nun, wenn aufgrund einer frischen Tätowierung gesundheitliche Komplikationen entstehen? Das Landesarbeitsgericht (LAG) Schleswig-Holstein entschied: Wer sich freiwillig tätowieren lässt, trägt auch das finanzielle Risiko einer durch Komplikationen verursachten Arbeitsunfähigkeit (Urteil vom 22.05.2025, 5 Sa 284 a724).
Krank wegen Tattoo
Eine Tätowierung führte bei einer Pflegehilfskraft zu einer Entzündung des Unterarms, weshalb sie für einige Tage arbeitsunfähig war. Für diesen Zeitraum legte sie eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vor. Die Beklagte verweigerte jedoch die Entgeltfortzahlung für den Zeitraum der Arbeitsunfähigkeit mit der Begründung, die Arbeitnehmerin treffe ein Verschulden an der Erkrankung.
Das Arbeitsgericht urteilte in erster Instanz, dass kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung bestehe. Die Klägerin legte daraufhin Berufung ein und betonte, dass das geringe Infektionsrisiko nicht vorhersehbar gewesen sei und Tätowierungen zur privaten Lebensführung gehörten. Die Arbeitgeberin verteidigte das erstinstanzliche Urteil, da eine Infektion nach einer Tätowierung kein Krankheitsrisiko sei, welches der Arbeitgeber finanziell zu tragen habe.
Kein Lohnfortzahlungsanspruch
Das LAG Schleswig-Holstein schloss sich der Argumentation des Arbeitsgerichts sowie des Arbeitgebers an: Die Arbeitsunfähigkeit der Klägerin war selbst verschuldet, insofern bestehe auch kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung.
Das Gericht begründete dies damit, dass die Beschäftigte mit dem Risiko einer Infektion nach der Tätowierung hätte rechnen müssen. Sie selbst hatte angegeben, dass solche Entzündungen in bis zu 5 % der Fälle auftreten können. Damit handele es sich nicht mehr um eine völlig fernliegende Komplikation. Ein solches Risiko ist vergleichbar mit häufigen Nebenwirkungen bei Medikamenten – diese gelten bereits ab einer Wahrscheinlichkeit von über 1 % als „häufig“. Wer sich bewusst einem solchen bekannten Risiko aussetzt, handelt vorsätzlich und verstößt gegen das eigene Interesse an der Erhaltung seiner Gesundheit. Dies erfülle die Voraussetzungen für ein Verschulden im Sinne des EFZG, so das LAG Schleswig-Holstein.
Da die Klägerin somit für ihre krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit selbst verantwortlich war, entfiel ihr Anspruch auf Lohnfortzahlung für die betreffenden Tage. Eine Revision zum Bundesarbeitsgericht wurde nicht zugelassen.
Lohnfortzahlung im TVöD bzw. TV-L
Das Urteil ist auch im Anwendungsbereich des TVöD respektive des TV-L zu beachten. Die Anspruchsgrundlage für die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall findet sich in § 22 Abs. 1 TVöD bzw. § 22 Abs. 1 TV-L. Ein Anspruch besteht jedoch auch hier nur, wenn Beschäftigte ohne ihr Verschulden infolge von Krankheit arbeitsunfähig sind. Der Verschuldensbegriff des § 3 Abs. 1 S. 1 EFZG entspricht im Wesentlichen dem der Tarifregelungen.