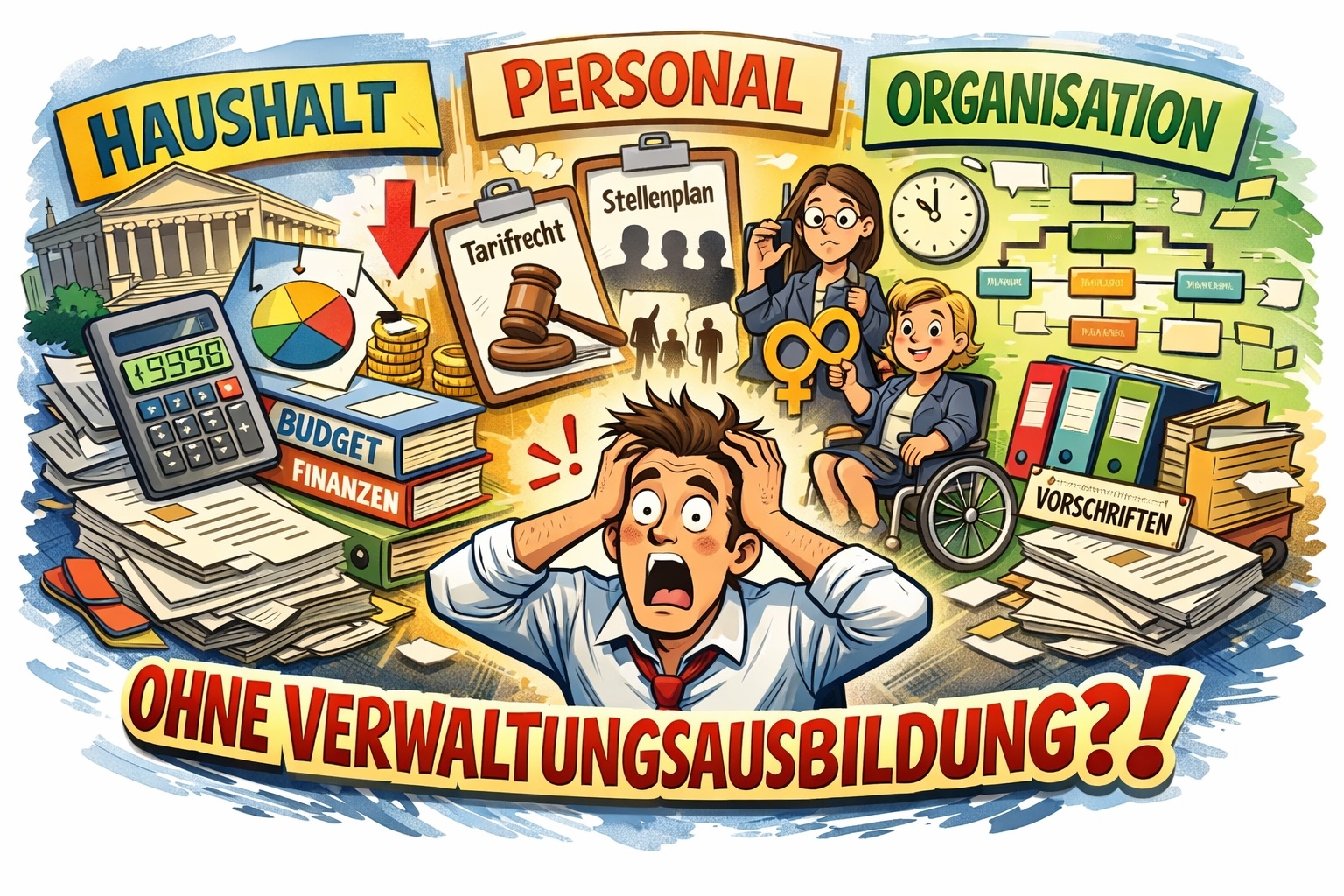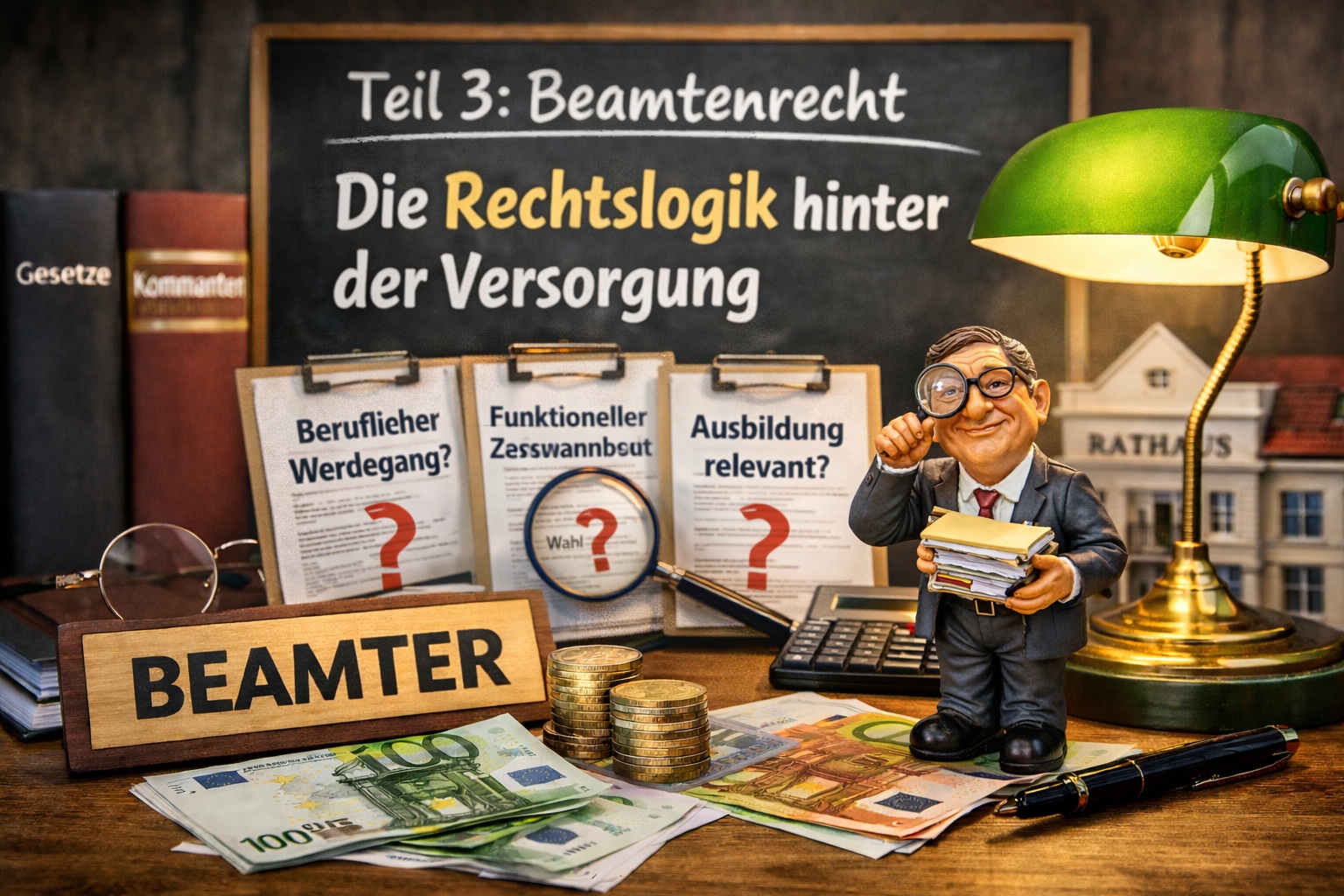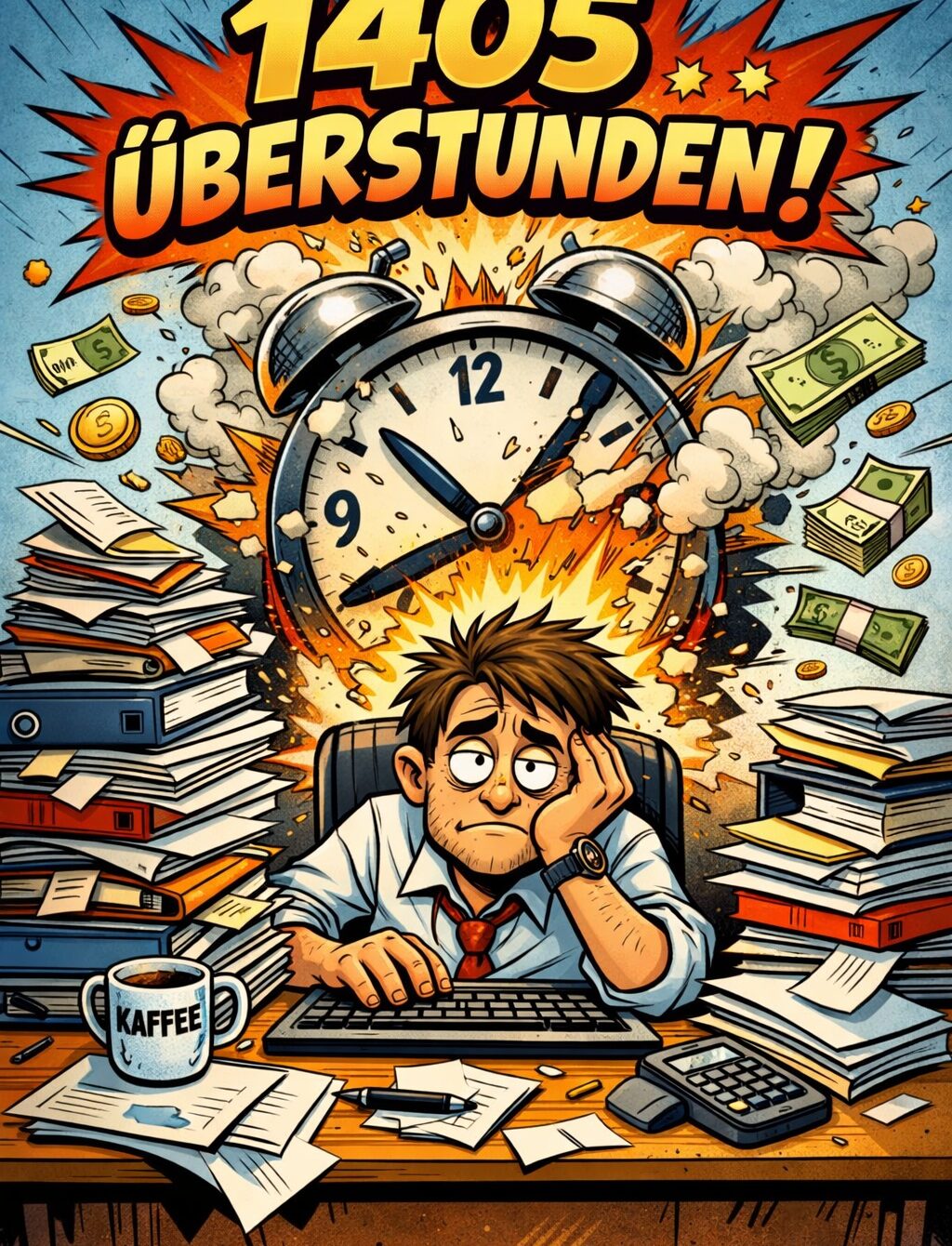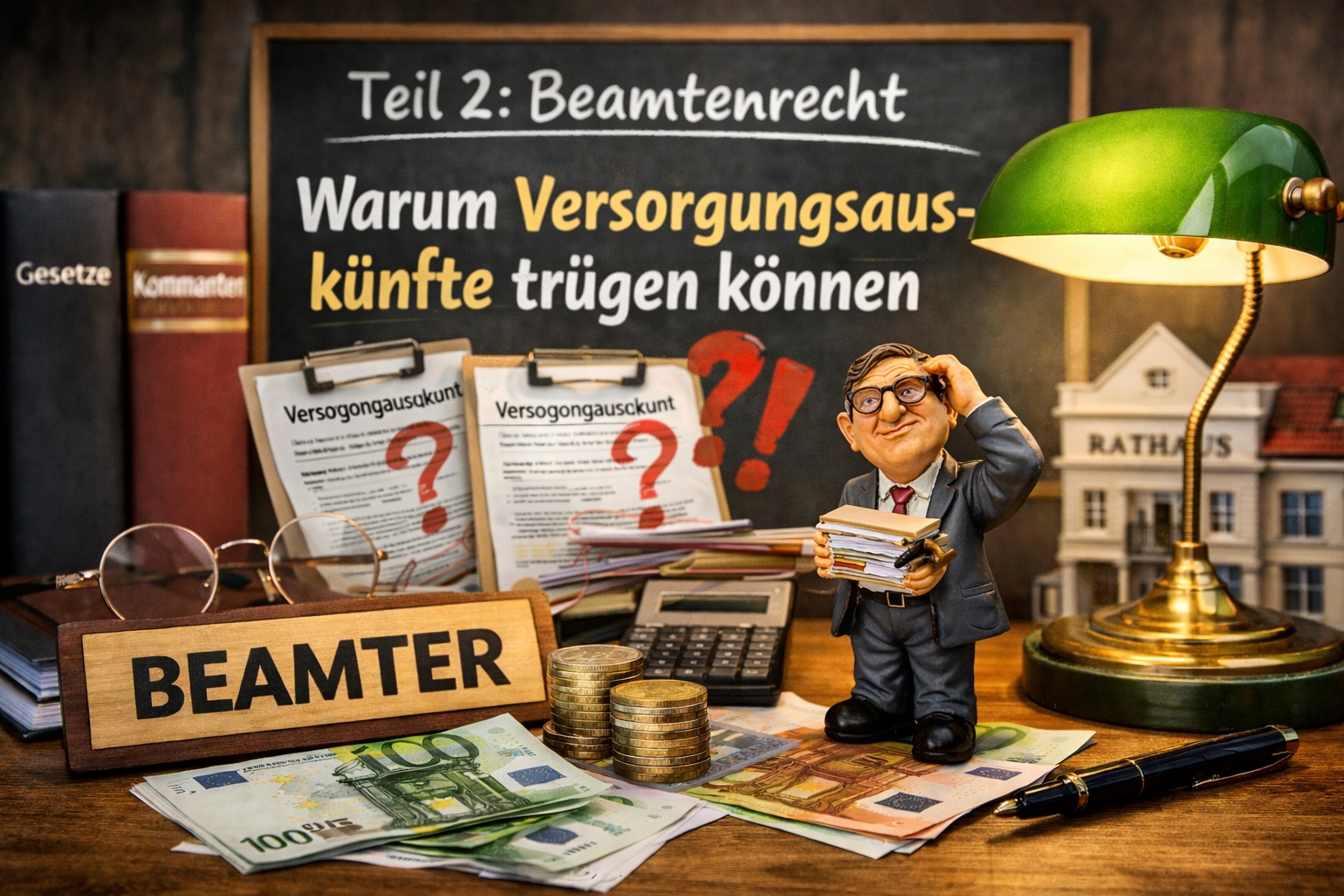Dienstherren dürfen nur in bestimmten Fällen in Sachen Erscheinungsbild der Mitarbeiter mitreden. In diesem Beitrag geht es darum, wann Vorgaben zu Haarlänge, Fingernägeln oder der Dienstkleidung aufgrund des Weisungsreichts arbeitsrechtlich zulässig sind.
Schwarze statt roter Hose
Das Aussehen von Beschäftigten führt immer wieder zu Auseinandersetzungen mit dem Arbeitgeber. So durfte ein Dienstherr nach Rechtsprechung des Landesarbeitsgerichts (LAG) Düsseldorf einem Mitarbeiter kündigen, da er zur Arbeit anstatt in der vorgegebenen roten in einer schwarzen Hose erschien (Urteil vom 21.05.2024, 3 SLa 224/24). Ganz grundsätzlich gehe es immer um eine Abwägung zwischen dem Weisungsrecht des Arbeitgebers im Verhältnis zum grundgesetzlich geschützten Persönlichkeitsrecht der Mitarbeiter. Nur mit einer guten Begründung dürften Arbeitgeber Beschäftigten Vorgaben zu ihrem Aussehen auf der Arbeit machen. Bei der roten Hose im oben genannten Fall, handelte es sich um eine Schutzkleidung, mit der Mitarbeiter gesehen werden sollen.
Wie weit darf der Arbeitgeber das Aussehen vorgeben?
Grundsätzlich ist jeder Beschäftigte erst einmal frei in der Entscheidung, was er oder sie anzieht oder wie er oder sie aussieht. Dennoch kann das Direktionsrecht des Dienstherrn des Dienstherrn auch Vorgaben zum Aussehen beinhaltet – sofern es eine gute Begründung hierfür gibt. Wenn derartige Einschränkungen mithin etwa aus hygienischen oder sicherheitstechnischen Vorschriften erwachsen, darf der Arbeitgeber Arbeitskleidung vorschreiben oder beispielsweise Piercings und lange Fingernägel verbieten. Auch Vorgaben, die ein einheitliches äußeres Erscheinungsbild zur Wahrung der „Corporate Identity“ vorschreiben, sind in der Regel wirksam. Dies bezieht sich allen voran auf das Tragen von Dienstuniformen oder von Kleidung mit Unternehmenslogo.
Das Körpergewicht oder der sog. „Body-Mass-Index“ (BMI) sind derweil für sich genommen kein zulässiger Beurteilungsmaßstab für die Eignung von Arbeitnehmern.
Berechtigte Arbeitgeberinteressen erlauben Vorgaben
Beschäftigten mit Kundenkontakt – beispielsweise im Bürgerbüro – darf der Dienstherr dabei mehr Vorschriften machen als anderen. Vorgaben, die das Aussehen von Arbeitnehmern nur während der Arbeitszeit einschränken, ohne Auswirkungen auf das Aussehen im Privatleben zu haben, dürften eher wirksam sein. Eine Beurteilung muss immer einzelfallbezogen vorgenommen werden. Auch die gesellschaftliche Akzeptanz des Aussehens spielt dabei eine Rolle. Dieses ändert sich naturgemäß immer wieder im Laufe der Zeit.
Gesellschaftliche Akzeptanz verändert die Beurteilung
Apropos: Heutzutage ist das Tragen von Bärten sehr in Mode. Insofern erscheint es unwahrscheinlich, dass ein Arbeitgeber dies grundlos verbietet. Auch die Akzeptanz von Tattoos und Piercings hat allgemein stark zugenommen, während eine Krawattenpflicht, wie sie vielerorts noch vor dreißig, vierzig Jahren praktiziert wurde, heute nicht mehr zeitgemäß erscheint.
Verbot der Diskriminierung: Keine Benachteiligung wegen des Aussehens erlaubt
Vorgaben, die das äußere Erscheinungsbild der Beschäftigten betreffen, dürfen diese nicht diskriminieren. Sie dürfen also nicht gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) oder gegen ein anderes Gesetz verstoßen. Insbesondere darf der Arbeitgeber niemanden wegen „der Rasse, der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität“ (§ 1 AGG) benachteiligen.
Dienstvereinbarung zum Erscheinungsbild sinnvoll
Möchte der Dienstherr den Beschäftigten besondere Vorgaben zum Aussehen machen, sollte er diese sinnvollerweise bereits in die Arbeitsverträge oder eine Betriebsvereinbarung aufnehmen. Mit der Unterschrift akzeptiert der Arbeitnehmer diese Regelung und kann sich später nicht mehr weigern, die Vorgabe umzusetzen, ohne eine Abmahnung oder Kündigung zu riskieren.
Bei der Regelung einer einheitlichen Dienstkleidung hat der Personalrat übrigens ein Mitbestimmungsrecht.